Mephisto / Мефистофель. Книга для чтения на немецком языке
Mephisto / Мефистофель. Книга для чтения на немецком языке
Клаус Манн
Ирина Олеговна Ситникова
Originallektüre Deutsch
Клаус Манн (1906-1949) – немецкий писатель и журналист, сын Томаса Манна.
В романе «Мефистофель» (1936) сатирически трактуется тема «соучастия» людей, не противостоявших фашизму внутри Германии.
Оригинальный текст снабжен постраничными комментариями и словарем.
Klaus Mann / Клаус Манн
Mephisto / Мефистофель. Книга для чтения на немецком zpsrt
Der Schauspielerin Therese Giehse gewidmet
Alle Fehler des Menschen verzeih ich dem Schauspieler, keine Fehler des Schauspielers verzeih ich dem Menschen.
Goethe, „Wilhelm Meister“
© КАРО, 2007
Vorspiel
1936
„In einem der westdeutschen Industriezentren sollen neulich über achthundert Arbeiter verurteilt worden sein, alle zu hohen Zuchthausstrafen, und das im Laufe eines einzigen Prozesses.“
„Nach meinen Informationen sind es nur fünfhundert gewesen; über hundert andere hat man erst gar nicht abgeurteilt, sondern heimlich umbringen lassen, ihrer Gesinnung wegen.“
„Sind die Löhne wirklich so entsetzlich schlecht?“
„Miserabel. Dabei fallen sie noch – und die Preise steigen.“
„Die Dekorierung des Opernhauses für heute abend soll sechzigtausend Mark gekostet haben. Dazu kommen mindestens noch vierzigtausend Mark andere Spesen – nicht mitgerechnet die Unkosten, die es der öffentlichen Kasse gemacht hat, das Opernhaus, wegen der Vorbereitungen für den Ball, fünf Tage lang geschlossen zu halten.“
„Eine nette kleine Geburtstagsfeier.“
„Ekelhaft, dass man den Rummel mitmachen muss.“
Die beiden jungen ausländischen Diplomaten verneigten sich, auf den Gesichtern das liebenswürdigste Lächeln, vor einem Offizier in großer Uniform, der hinter seinem Monokel einen misstrauischen Blick auf sie geworfen hatte.
„Die ganze hohe Generalität ist da.“ Sie sprachen erst wieder, als sie die große Uniform außer Hörweite wussten.
„Aber sie sind alle für den Frieden begeistert“, fügte der andere boshaft hinzu.
„Wie lange noch?“ fragte fröhlich lächelnd der erste, wobei er eine kleine Dame von der japanischen Botschaft begrüßte, die am Arm eines hünenhaften Marineoffiziers klein und zierlich einherschritt.
„Wir müssen auf alles gefasst sein.“
Ein Herr vom Auswärtigen Amt gesellte sich zu den beiden jungen Botschaftsattaches, die sofort dazu übergingen, Pracht und Schönheit der Saaldekoration zu preisen. „Ja, der Herr Ministerpräsident hat Freude an diesen Dingen“, sagte, etwas verlegen, der Herr vom Auswärtigen Amt. – „Aber es ist alles geschmackvoll“, versicherten die beiden jungen Diplomaten, beinah im gleichen Atem. – „Gewiss“, sprach gequält der Herr aus der Wilhelmstraße[1 - Wilhelmstraße: eine Straße in den Berliner Ortsteilen Mitte und Kreuzberg. Sie war der Sitz wichtiger Regierungsbehörden Preußens und des Deutschen Reiches. Bis 1945 war der Begriff „Wilhelmstraße“ ein Synonym für diedeutsche Regierung.]. – „Eine so prachtvolle Veranstaltung kann man heute nirgends als in Berlin finden“, sagte einer der beiden Ausländer noch. Der Herr vom Außenministerium zögerte eine Sekunde lang, ehe er sich zu einem, höflichen Lächeln entschloss.
Es entstand eine Gesprächspause. Die drei Herren blickten um sich und lauschten dem festlichen Lärm. „Kolossal“, sagte schließlich einer von den beiden jungen Leuten leise – diesmal ohne jeden Sarkasmus, sondern wirklich beeindruckt, beinah verängstigt von dem riesenhaften Aufwand, der ihn umgab. Das Flimmern der von Lichtern und Wohlgerüchen gesättigten Luft war so stark, dass es ihm die Augen blendete. Ehrfurchtsvoll, aber misstrauisch blinzelte er in den bewegten Glanz. ,Wo bin ich nur?’ dachte der junge Herr – er kam aus einem der skandinavischen Länder —. ,Der Ort, an dem ich mich befinde, ist ohne Frage sehr lieblich und verschwenderisch ausgestattet; dabei aber auch etwas grauenhaft. Diese schön geputzten Menschen sind von einer Munterkeit, die nicht gerade vertrauenerweckend wirkt. Sie bewegen sich wie die Marionetten – sonderbar zuckend und eckig. In ihren Augen lauert etwas, ihre Augen haben keinen guten Blick, es gibt in ihnen soviel Angst und soviel Grausamkeit. Bei mir zu Hause schauen die Leute auf eine andere Art – sie schauen freundlicher und freier bei mir zu Hause. Man lacht auch anders bei uns droben im Norden. Hier haben die Gelächter etwas Höhnisches und etwas Verzweifeltes; etwas Freches, Provokantes, und dabei etwas Hoffnungsloses, schauerlich Trauriges. So lacht doch niemand, der sich wohl fühlt in seiner Haut. So lachen doch Männer und Frauen nicht, die ein anständiges, vernünftiges Leben führen…’
Der große Ball zum dreiundvierzigsten Geburtstag des Ministerpräsidenten fand in allen Räumen des Opernhauses statt. In den ausgedehnten Foyers, in den Couloirs und Vestibülen bewegte sich die geputzte Menge. Sie ließ Sektpfropfen knallen in den Logen, deren Brüstungen mit kostbaren Draperien behängt waren; sie tanzte im Parkett, aus dem man die Stuhlreihen entfernt hatte. Das Orchester, das auf der leergeräumten Bühne seinen Platz hatte, war umfangreich, als sollte es eine Symphonie aufführen, mindestens von Richard Strauss. Es spielte aber nur, in keckem Durcheinander, Militärmärsche und jene Jazzmusik, die zwar wegen niggerhafter Unsittlichkeit verpönt war im Reiche, die aber der hohe Würdenträger auf seinem Jubelfeste nicht entbehren wollte.
Hier hatte alles sich eingefunden, was in diesem Lande etwas gelten wollte, niemand fehlte – außer dem Diktator selbst, der sich wegen Halsschmerzen und angegriffener Nerven hatte entschuldigen lassen, und außer einigen etwas plebejischen Parteiprominenten, die nicht eingeladen worden waren. Hingegen bemerkte man mehrere kaiserliche und königliche Prinzen, viele Fürstlichkeiten und fast den ganzen Hochadel; die gesamte Generalität der Wehrmacht, sehr viel einflussreiche Finanziers und Schwerindustrielle; verschiedene Mitglieder des diplomatischen Korps – meistens von den Vertretungen kleinerer oder weit entfernter Länder —; einige Minister, einige berühmte Schauspieler – die huldvolle Schwäche des Jubilars für das Theater war bekannt – und sogar einen Dichter, der sehr dekorativ aussah und übrigens die persönliche Freundschaft des Diktators genoss. Über zweitausend Einladungen waren verschickt worden; von diesen waren etwa tausend Ehrenkarten, die zum unentgeltlichen Genuss des Festes berechtigten; von den Empfängern der übrigen tausend hatte jeder fünfzig Mark Eintritt zahlen müssen: So kam ein Teil der ungeheuerm Spesen wieder herein – der Rest blieb zu Lasten jener Steuerzahler, die nicht zum nähereil Umgang des Ministerpräsidenten und also keineswegs zur Elite der neuen deutschen Gesellschaft gehörten.
„Ist es nicht ein wunderschönes Fest!“ rief die umfangreiche Gattin eines rheinischen Waffenfabrikanten der Frau eines südamerikanischen Diplomaten zu. „Ach, ich amüsiere mich gar zu gut! Ich bin so glänzender Laune, und ich wünschte mir, dass alle Menschen in Deutschland, und überall, glänzender Laune würden!“
Die südamerikanische Diplomatenfrau, die nicht gut Deutsch verstand und sich langweilte, lächelte säuerlich.
Die muntere Gattin des Fabrikanten war von solchem Mangel an Enthusiasmus enttäuscht und entschloss sich dazu, weiter zu promenieren. „Entschuldigen Sie mich, meine Liebe!“ sagte sie fein und raffte die glitzernde Schleppe. „Ich muss eben mal eine alte Freundin aus Köln begrüßen – die Mutter unseres Staatstheaterintendanten, Sie wissen doch, des großen Hendrik Höfgen.“
Hier tat die Südamerikanerin zum erstenmal den Mund auf, um zu fragen: „Who is Henrik Hopfgen?“ – was die Fabrikantengattin veranlasste, leise aufzuschreien: „Wie?! Sie kennen unseren Höfgen nicht? Höfgen, meine Beste – nicht Hopfgen! Und Hendrik, nicht Henrik – er legt größten Wert auf das kleine ,d’!“ Dabei war sie schon auf die distinguierte Matrone zugeeilt, die am Arme des Dichters und Führerfreundes würdevoll durch die Säle schritt. „Liebste Frau Bella! Es ist eine Ewigkeit her, dass man sich nicht gesehen hat! Wie geht es Ihnen denn, Liebste? Haben Sie manchmal Heimweh nach unserem Köln? Aber Sie befinden sich hier ja in einer so glänzenden Position! Und wie geht es Fräulein Josy, dem lieben Kind? Vor allem: Was macht Hendrik – Ihr großer Sohn! Himmel, was ist aus ihm alles geworden! Er ist ja fast so bedeutend wie ein Minister! Jaja, liebste Frau Bella, wir in Köln haben alle Sehnsucht nach Ihnen und Ihren herrlichen Kindern!“
In Wahrheit hatte sich die Millionärin niemals um Frau Bella Höfgen gekümmert, als diese noch in Köln gelebt und ihr Sohn die große Karriere noch nicht gemacht hatte. Die Bekanntschaft zwischen den beiden Damen war nur eine flüchtige gewesen; niemals war Frau Bella eingeladen worden in die Villa des Fabrikanten. Nun aber wollte die lustige und gemütvolle Reiche die Hand der Frau, deren Sohn man zu den nahen Freunden des Ministerpräsidenten zählte, gar nicht mehr loslassen.
Frau Bella lächelte huldvoll. Sie war sehr einfach, aber nicht ohne eine gewisse ehrbare Koketterie gekleidet; auf ihrer schwarzen, glatt fließenden Seidenrobe leuchtete eine weiße Orchidee. Das graue, schlicht frisierte Haar bildete einen pikanten Kontrast zu ihrem ziemlich jung gebliebenen, mit dezenter Sorgfalt hergerichteten Gesicht. Aus weiten, grünblauen Augen schaute sie mit einer reservierten, nachdenklichen Freundlichkeit auf die geschwätzige Dame, die den lebhaften deutschen Kriegsvorbereitungen ihr wundervolles Kollier, ihre langen Ohrgehänge, die Pariser Toilette und all ihren Glanz verdankte.
„Ich kann nicht klagen, es geht uns allen recht gut“ sprach mit stolzer Bescheidenheit Frau Höfgen. „Josy hat sich mit dem jungen Grafen Donnersberg verlobt. Hendrik ist ein wenig überanstrengt, er hat rasend zu tun.“
„Das kann ich mir denken.“ Die Industrielle schaute respektvoll.
„Darf ich Ihnen unseren Freund Cäsar von Muck vorstellen“, sagte Frau Bella.
Der Dichter neigte sich über die geschmückte Hand der reichen Dame, die sofort wieder zu schwätzen begann. „Ungeheuer interessant, ich freue mich wirklich, habe Sie sofort nach den Fotografien erkannt. Ihr ,Tannenberg’-Drama habe ich in Köln bewundert, eine recht gute Aufführung, natürlich fehlen die überragenden Leistungen, wie man sie in Berlin jetzt gewöhnt ist, aber wirklich recht anständig, ohne Frage sehr achtbar. Und Sie, Herr Staatsrat – Sie haben doch inzwischen eine so großartige Reise gemacht, alle Welt spricht von Ihrem Reisebuch, ich will es mir dieser Tage besorgen.“
„Ich habe viel Schönes und viel Hässliches gesehen in der Fremde“, sagte der Dichter schlicht. „Jedoch reiste ich durch die Lande nicht nur als Schauender, nicht nur als Genießender, sondern mehr noch als Wirkender, Lehrender. Mich deucht, es ist mir gelungen, dort draußen neue Freunde für unser neues Deutschland zu werben.“ Mit seinen stahlblauen Augen, deren durchdringende und feurige Reinheit in vielen Feuilletons gepriesen wurde, taxierte er den kolossalen Schmuck der Rheinländerin. ,Ich könnte in ihrer Villa wohnen, wenn ich das nächste Mal in Köln einen Vortrag oder eine Premiere habe’, dachte er, während er weitersprach: „Es ist für unseren geraden Sinn unfassbar, wieviel Lüge, wieviel boshaftes Missverständnis über unser Reich im Umlauf sind – draußen in der Welt.“
Sein Gesicht war so beschaffen, dass jeder Reporter es „holzgeschnitten“ nennen musste: zerfurchte Stirne, Stahlauge unter blonder Braue und ein verkniffener Mund, der leicht sächsischen Dialekt sprach. Die Waffenfabrikantin war sehr beeindruckt, von seinem Aussehen wie von seiner edlen Rede. „Ach“, schaute sie ihn schwärmerisch an. „Wenn Sie einmal nach Köln kommen, müssen Sie uns unbedingt besuchen!“
Staatsrat Cäsar von Muck, Präsident der Dichterakademie und Verfasser des überall gespielten „Tannenberg“-Dramas, verneigte sich mit ritterlichem Anstand: „Es wird mir eine echte Freude sein, gnädige Frau.“ Dabei legte er sogar die Hand aufs Herz.
Die Industrielle fand ihn wundervoll. „Wie köstlich es sein wird, Ihnen einen ganzen Abend zuzuhören, Exzellenz[2 - Exzellenz: verwendet als Anrede oder Titel für hohe Diplomaten.]!“ rief sie aus. „Was Sie alles erlebt haben müssen! Sind Sie nicht auch schon Staatstheaterintendant gewesen?“
Diese Frage wurde als taktlos empfunden, und zwar sowohl von der distinguierten Frau Bella als auch vom Autor der „Tannenberg“-Tragödie. Dieser sagte denn auch nur, mit einer gewissen Schärfe: „Gewiss.“
Die reiche Kölnerin merkte nichts. Vielmehr sprach sie noch, mit durchaus deplacierter Schelmerei: „Sind Sie denn da nicht ein klein bisschen eifersüchtig, Herr Staatsrat, auf unseren Hendrik, Ihren Nachfolger?“ Nun drohte sie auch noch mit dem Finger. Frau Bella wusste nicht, wohin sie blicken sollte.
Cäsar von Muck aber bewies, dass er weltmännisch und überlegen war, und zwar in einem Grade, der an Edelmut grenzt. Über sein Holzschnittgesicht ging ein Lächeln, das nur in seinen ersten Anfängen etwas bitter schien, dann aber milde, gut und sogar weise wurde. „Ich habe diese schwere Last gerne – ja, von Herzen gerne an meinen Freund Höfgen abgegeben, der wie kein anderer berufen ist, sie zu tragen.“ Seine Stimme bebte; er war stark ergriffen von der eigenen Großmut und von der Schönheit seiner Gesinnung.
Frau Bella, die Mutter des Intendanten, zeigte eine beeindruckte Miene; die Lebensgefährtin des Kanonenkönigs aber war derartig gerührt von der edlen und majestätischen Haltung des berühmten Dramatikers, dass sie beinahe weinen musste. Mit tapferer Selbstüberwindung schluckte sie die Tränen hinunter; tupfte sich die Augen flüchtig mit dem Seidentüchlein und schüttelte die weihevolle Stimmung mit einem sichtbaren Ruck von sich ab. In ihr siegte die typisch rheinische Munterkeit; sie schaute wieder strahlend und jubilierte: „Ist es nicht ein ganz herrliches Fest?!“
Es war ein ganz herrliches Fest, darüber konnte gar kein Zweifel bestehen. Wie das glitzerte, duftete, rauschte! Gar nicht festzustellen, was mehr Glanz verbreitete: die Juwelen oder die Ordenssterne. Das verschwenderische Licht der Kronleuchter spielte und tanzte auf den entblößten, weißen Rücken und den schön bemalten Mienen der Damen; auf den Specknacken, gestärkten Hemdbrüsten oder betressten Uniformen feister Herren; auf den schwitzenden Gesichtern der Lakaien, die mit den Erfrischungen umherliefen. Es dufteten die Blumen, die in schönem Arrangement verteilt waren, durch das ganze Lusthaus; es dufteten die Pariser Parfüms all der deutschen Frauen; es dufteten die Zigarren der Industriellen und die Pomaden der schlanken Jünglinge in ihren kleidsam knappen SS[3 - SS: eine Art militärisch organisierter Polizei in der Zeit des Nationalsozialismus.]-Uniformen; es dufteten die Prinzen und die Prinzessinnen, die Chefs der Geheimen Staatspolizei, die Feuilletonchefs, die Filmdivas, die Universitätsprofessoren, die einen Lehrstuhl für Rassenoder Wehrwissenschaft innehatten, und die wenigen jüdischen Bankiers, deren Reichtum und internationale Beziehungen so gewaltig waren, dass man sie sogar an dieser exklusiven Veranstaltung teilhaben ließ. Man verbreitete Wolken künstlichen Wohlgeruchs, als gälte es, ein anderes Aroma nicht aufkommen zu lassen – den faden, süßlichen Gestank des Blutes, den man zwar liebte und von dem das ganze Land erfüllt war, dessen man sich aber bei so feinem Anlass und in Gegenwart der fremden Diplomaten ein wenig schämte.
„Tolle Sache“, sagte ein hoher Herr von der Reichswehr zum anderen. „Was der Dicke sich alles leistet!“
„Solange wir es uns gefallen lassen“, sagte der zweite. Sie machten gutgelaunte Gesichter; denn sie wurden fotografiert.
„Lotte soll ein Kleid anhaben, das dreitausend Mark kostet“, erzählte eine Filmschauspielerin dem Hohenzollernprinzen[4 - Hohenzollern: Das Haus Hohenzollern ist eines der bedeutendsten deutschen Fürstengeschlechter, ursprünglich aus dem schwäbischen Raum. Es untergliederte sich seit dem Mittelalter in mehrere Haupt- und Nebenlinien, von denen einige wieder erloschen sind. Die (ursprünglich fränkische) Linie Brandenburg-Preußen stellte ab 1701 die preußischen Könige und von 1871 bis 1918 die Deutschen Kaiser. Das Haus Hohenzollern stellte außerdem von 1866 bis 1947 die rumänischen Könige.], mit dem sie tanzte. Lotte war das Eheweib des Gewaltigen mit den vielen Titeln, der sich zu seinem dreiundvierzigsten Geburtstag feiern ließ wie ein Märchenprinz. Lotte war eine Provinzschauspielerin gewesen und galt als herzensgute, schlichte, urdeutsche Frau. An ihrem Hochzeitstage hatte der Märchenprinz zwei Proleten[5 - Prolet: jemand, der sehr schlechte Manieren hat.] hinrichten lassen.
Der Hohenzollernprinz sagte: „Einen solchen Aufwand hat meine Familie niemals getrieben. – Wann wird das hohe Paar denn übrigens Einzug halten? Unsere Erwartung soll wohl auf das äußerste gesteigert werden!“
„Lottchen versteht’s“, meinte sachlich die ehemalige Kollegin der Landesmutter. – Ein ausgesprochen herrliches Fest: Alle Anwesenden schienen es aufs intensivste zu genießen, sowohl die mit den Ehrenkarten als auch die anderen, die fünfzig Mark hatten zahlen müssen, um dabeisein zu dürfen. Man tanzte, schwatzte, flirtete; man bewunderte sich selber, die anderen und am meisten die Macht, die sich so üppige Veranstaltungen wie diese gönnen durfte. In den Logen und Wandelgängen, an den verführerischen Büfetts waren die Konversationen sehr lebhaft. Man diskutierte über die Toiletten der Damen, über das Vermögen der Herren und über die Preise, welche die Wohltätigkeitstombola bringen würde: Als das wertvollste Stück wurde ein Hakenkreuz aus Brillanten genannt, etwas sehr Niedliches und Teures, als Brosche oder als Anhänger an einem Kollier zu tragen. Eingeweihte wollten wissen, dass es auch höchst amüsante Trostpreise geben würde, zum Beispiel naturgetreu nachgebildete Tanks und Maschinengewehre aus Lübecker Marzipan. Einige Damen behaupteten launig, dass sie noch lieber ein Mordinstrument aus so süßem Stoff haben wollten als das kostbare Hakenkreuz. Es wurde viel und herzlich gelacht. Mit gedämpfteren Stimmen besprach man sich über die politischen Hintergründe der Veranstaltung. Es fiel auf, dass der Diktator abgesagt hatte und mehrere Parteiprominente nicht eingeladen worden waren; dass man aber Mitglieder der fürstlichen Familien in so großer Anzahl anwesend sah. An diesen Umstand knüpften sich mancherlei dunkle und bedeutungsvolle Gerüchte, die man sich im Flüstertöne weitergab. Auch über den Gesundheitszustand des Diktators wollte der oder jener finstere Neuigkeiten wissen; man besprach sie leise und leidenschaftlich, sowohl im Kreise der auswärtigen Pressevertreter und Diplomaten als auch bei den Herren von der Reichswehr und der Schwerindustrie.
„Es scheint also doch Krebs zu sein“, berichtete hinter vorgehaltenem Taschentuch ein Herr von der englischen Presse dem Pariser Kollegen. Bei diesem aber war er an den Falschen geraten. Pierre Larue hatte das Aussehen eines höchst gebrechlichen, dabei recht tückischen Zwerges; schwärmte aber für den Heroismus und für die schönen uniformierten Burschen des neuen Deutschland. Übrigens war er kein Journalist, sondern ein reicher Mann, der verklatschte Bücher über das gesellschaftliche, literarische und politische Leben der europäischen Hauptstädte schrieb und dessen Lebensinhalt es bedeutete, berühmte Bekanntschaften zu sammeln. Dieser ebenso groteske wie anrüchige kleine Kobold, mit dem spitzen Gesichtchen und der lamentierenden Fistelstimme einer kränklichen alten Dame, verachtete die Demokratie seines eigenen Landes und erklärte jedem, der es hören wollte, dass er Clemenceau[6 - Clemenceau, Georges Benjamin, frz. Staatsmann; 1906 bis 1909 und 1917 bis 1920 Minister-Präsident; setzte die frz. Forderungen gegenüber Deutschland im Versailler Vertrag durch.] für einen Schurken und Briand[7 - Briand, Aristide, frz. Staatsmann; war elfmal Ministerpräsident, 1925 bis 1932 Außenminister, beteiligt am Locarno-Pakt.] für einen Idioten halte, jeden höheren Gestapobeamten jedoch für einen Halbgott und die Spitzen des neudeutschen Regimes für eine Garnitur von tadellosen Göttern.
„Was verbreiten Sie für infamen Unsinn, mein Herr!“ Das Männchen schaute erschreckend boshaft; seine Stimme raschelte dürr wie gefallenes Laub. „Der Gesundheitszustand des Führers lässt nichts zu wünschen übrig. Er ist nur ein bisschen erkältet.“
Diesem kleinen Scheusal war es zuzutrauen, dass er hinging und denunzierte. Der englische Korrespondent wurde nervös; er versuchte, sich zu rechtfertigen: „Ein italienischer Kollege hat mir im Vertrauen so etwas angedeutet…“ Aber der schmächtige Liebhaber prall gefüllter Uniformen schnitt ihm mit Strenge das Wort ab:
„Genug, mein Herr! Ich will nichts mehr hören! Das ist alles unverantwortliches Geschwätz! – Entschuldigen Sie“, fügte er sanfter hinzu. „Ich muss den Exkönig von Bulgarien begrüßen. Die Prinzessin von Hessen ist bei ihm, ich habe die Bekanntschaft Ihrer Hoheit am Hofe ihres Vaters in Rom gemacht.“ Er rauschte davon, die bleichen und spitzen Händchen auf der Brust gefaltet, in der Haltung und mit dem Gesichtsausdruck eines intriganten Abbés[8 - Abbé [frz. „Abt“]: in Frankreich Titel des Weltgeistlichen.]. Der Engländer murmelte hinter ihm her: „Damned snob[9 - Damned snob: verdammter Snob.].“
Eine Bewegung ging durch den Saal, es gab ein hörbares Rauschen: Der Propagandaminister war eingetreten. Man hatte ihn heute abend nicht hier erwartet, alle wussten um seine gespannte Beziehung zu dem fetten Geburtstagskind – das sich übrigens seinerseits noch immer verborgen hielt, um aus seinem Entree dann den ganz großen Clou zu machen.
Der Propagandaminister – Herr über das geistige Leben eines Millionenvolkes – humpelte behende durch die glänzende Menge, die sich vor ihm verneigte. Eine eisige Luft schien zu wehen, wo er vorbeiging. Es war, als sei eine böse, gefährliche, einsame und grausame Gottheit herniedergestiegen in den ordinären Trubel genusssüchtiger, feiger und erbärmlicher Sterblicher. Einige Sekunden lang war die ganze Gesellschaft wie gelähmt von Entsetzen. Die Tanzenden erstarrten mitten in ihrer anmutigen Pose, und ihr scheuer Blick hing, zugleich demütig und hassvoll, an dem gefürchteten Zwerg. Der versuchte durch ein charmantes Lächeln, welches seinen mageren, scharfen Mund bis zu den Ohren hinaufzerrte, die schauerliche Wirkung, die von ihm ausging, ein wenig zu mildern; er gab sich Mühe, zu bezaubern, zu versöhnen und seine tiefliegenden, schlauen Augen freundlich blicken zu lassen. Seinen Klumpfuß graziös hinter sich her ziehend, eilte er gewandt durch den Festsaal und zeigte dieser Gesellschaft von zweitausend Sklaven, Mitläufern, Betrügern, Betrogenen und Narren sein falschbedeutendes Raubvogelprofil. An den Gruppen von Millionären, Botschaftern, Divisionskommandanten und Filmstars huschte er, tückisch lächelnd, vorüber. Es war der Intendant Hendrik Höfgen, Staatsrat und Senator, bei welchem er stehenblieb.
Noch eine Sensation! Intendant Höfgen gehörte zu den deklarierten Favoriten des Minis-terpräsidenten und Fliegergenerals, der seine Berufung an die Spitze der Staatstheater durchgesetzt hatte gegen den Willen des Propaganda-ministers. Dieser war, nach einem langen und heftigen Kampf, dazu gezwungen worden, seinen eigenen Protegé, den Dichter Cäsar von Muck, zu opfern und auf Reisen zu schicken. Nun aber ehrte er demonstrativ das Geschöpf seines Feindes durch seine Begrüßung und durch sein Gespräch. Wollte der schlaue Meister der Propaganda auf solche Weise vor der internationalen Elitegesellschaft bekunden, dass es Unstimmigkeiten und Ränke zwischen den Spitzen des deutschen Regimes gar nicht gebe und dass die Eifersucht zwischen ihm, dem Reklamechef, und dem Fliegergeneral ins hässliche Gebiet der Greuelmärchen gehöre? Oder war Hendrik Höfgen – eine der meistbesprochenen Figuren der Hauptstadt – seinerseits so unermesslich schlau, dass er es fertigbrachte, zum Propagandaminister ebenso intime Beziehungen zu unterhalten wie zum Fliegergeneral – Ministerpräsidenten? Spielte er den einen Machthaber gegen den anderen aus, ließ sich von den beiden großen Konkurrenten protegieren? Seiner legendären Geschicklichkeit wäre es zuzutrauen…
Das war ja alles ungeheuer interessant! Pierre Larue ließ den Exkönig von Bulgarien einfach stehen und trippelte durch den Saal – von seiner Neugierde dahingeweht wie eine Feder vom Winde —, um dieses sensationelle Renkontre[10 - Renkontre: Treffen, Begegnung.] aus der nächsten Nähe mit anzuschauen, Cäsar von Mucks stählerne Augen kniffen sich misstrauisch zusammen, die Millionärin aus Köln stöhnte wollüstig vor lauter Angeregtheit und Freude an der erhabenen Situation; während Frau Bella Höfgen, die Mutter des großen Mannes, allen, die in ihrer Nähe standen, gnädig und gleichsam ermunternd zulächelte, als wollte sie ihnen bedeuten: Mein Hendrik ist groß, und ich bin seine distinguierte Mutter. Trotzdem braucht ihr nun nicht gleich in die Knie zu sinken. Er und ich, wir sind auch nur von Fleisch und Blut, wenngleich sonst ausgezeichnet vor den übrigen Menschen.
„Wie geht es Ihnen, mein lieber Höfgen?“ fragte der Propagandaminister anmutig lächelnd den Intendanten. Auch der Intendant lächelte, aber nicht gleich bis zu den Ohren hinauf, sondern mit einer Vornehmheit, die fast schmerzlich wirkte. „Ich danke Ihnen, Herr Minister!“ Er sprach leise, etwas singenden Tones, dabei äußerst akzentuiert. Der Minister hatte seine Hand noch immer nicht losgelassen. „Darf ich mich nach dem Befinden Ihrer Frau Gemahlin erkundigen“, sagte der Intendant, und nun musste sein hoher Gesprächspartner endlich ein ernstes Gesicht machen. „Sie ist heute abend ein wenig unpässlich.“ Dabei ließ er die Hand des Senators und Staatsrats los. Dieser sagte wehmütig: „Wie leid mir das tut.“
Natürlich wusste er – was allen hier im Saale bekannt war —, dass die Frau des Propagandaministers völlig verzehrt und innerlich verwüstet war von Eifersucht auf die Gattin des Ministerpräsidenten. Da der Diktator selber unverehelicht blieb, war das angetraute Weib des Reklamechefs die Erste Dame im Reiche gewesen, und sie hatte diese ihre gottgewollte Funktion mit Anstand und Würde erfüllt, ihr Todfeind konnte es nicht bestreiten.
Dann aber kam diese Lotte Lindenthal daher, eine mittlere Schauspielerin – jung war sie auch nicht mehr —, und ließ sich heiraten von dem prachtliebenden Dicken. Die Frau des Propagandaministers litt unbeschreiblich. Man machte ihr den Rang der Ersten Dame streitig! Eine andere drängte sich vor! Mit einer Komödiantin ward ein Kult getrieben, als ob die Königin Luise[11 - Königin Luise (
1776, †1810), Königin von Preußen, Gemahlin Friedrich Wilhelms III.] auferstanden wäre! Immer wenn es eine Veranstaltung zu Lottes Ehren gab, ärgerte sich Frau Reklamechef so ungeheuer, dass sie Migräne bekam. Auch heute abend war sie im Bett geblieben.
„Gewiss hätte sich Ihre Frau Gemahlin hier sehr gut unterhalten.“ Höfgen machte immer noch die feierliche Miene. In seinen Worten war von Ironie keine Spur zu finden. „Zu schade, dass der Führer absagen musste. Auch der englische und der französische Botschafter sind verhindert.“
Mit diesen Feststellungen, die er in sanftestem Tone vorbrachte, verriet Höfgen seinen eigentlichen Freund und Gönner – den Ministerpräsidenten, dem er all seinen Glanz zu danken hatte – an den eifersüchtigen Propagandaminister. Diesen aber hielt er sich für alle Fälle in der Reserve.
Der gewandte Klumpfuß fragte vertraulich, nicht ohne Hohn: „Und wie ist hier die Stimmung?“
Der Intendant der Staatstheater sagte zurückhaltend: „Man scheint sich zu amüsieren.“
Die beiden Würdenträger führten ihre Unterhaltung leise; denn um sie drängten sich Neugierige, auch mehrere Fotografen waren herbeigekommen. Die Kanonenfabrikantin flüsterte eben Pierre Larue zu, der in Verzückung die bleichen Knochenhändchen über der Brust gegeneinander rieb: „Unser Intendant und der Minister – sind sie nicht ein herrliches Paar? Beide so bedeutend! Beide so schön!“ Sie drängte ihren üppigen, geschmückten Leib nahe an das gebrechliche Körperchen des Kleinen. Der zarte gallische Liebhaber des germanischen Heroismus, der strammen Jünglinge, des Führergedankens und der hohen Adelsnamen fürchtete sich vor der atmenden Nähe soviel weiblichen Fleisches. Er versuchte, sich ein wenig zurückzuziehen, während er zirpte: „Exquisit! Ganz charmant! Unvergleichlich!“ Die Rheinländerin beteuerte: „Unser Höfgen – das ist ein ganzer Mann, sage ich Ihnen! Ein Genie, so etwas gibt es weder in Paris noch in Hollywood! Und so urdeutsch, so gerade, einfach und ehrlich! Ich habe ihn ja schon gekannt, als er noch so klein gewesen ist.“ Mit der vorgestreckten Hand deutete sie an, wie klein Hendrik gewesen war, als sie, die Millionärin, seine Mutter auf den Kölner Wohltätigkeitsveranstaltungen konsequent geschnitten hatte. „Ein herrlicher Junge!“ sagte sie noch und bekam so sinnliche Augen, dass Larue panisch die Flucht ergriff.
Man hätte Hendrik Höfgen für einen Mann von etwa fünfzig Jahren gehalten; er war aber erst neununddreißig – ungeheuer jung für seinen hohen Posten. Seine fahle Miene mit der Hornbrille zeigte jene steinerne Ruhe, zu der sich sehr nervöse und sehr eitle Menschen zwingen können, wenn sie sich von vielen Leuten beobachtet wissen. Sein kahler Schädel hatte edle Form. Im aufgeschwemmten, grauweißen Gesicht fiel der überanstrengte, empfindliche und leidende Zug auf, der von den hochgezogenen blonden Brauen zu den vertieften Schläfen lief; außerdem die markante Bildung des starken Kinns, das er auf stolze Art hochgereckt trug, so dass die vornehm schöne Linie zwischen Ohr und Kinn kühn und herrisch betont ward. Auf seinen breiten und blassen Lippen lag ein erfrorenes, vieldeutiges, zugleich höhnisches und um Mitleid werbendes Lächeln. Hinter den großen, spiegelnden Brillengläsern wurden seine Augen nur zuweilen sichtbar und wirksam: Dann erkannte man, nicht ohne Schrecken, dass sie, bei aller Weichheit, eiskalt, bei aller Melancholie sehr grausam waren. Diese grüngrau schillernden Augen ließen an Edelsteine denken, die kostbar sind, aber Unglück bringen; gleichzeitig an die gierigen Augen eines bösen und gefährlichen Fisches. – Alle Damen und die meisten Herren fanden, dass Hendrik Höfgen nicht nur ein bedeutender und höchst geschickter, sondern auch ein bemerkenswert schöner Mann sei. Seine zusammengenommene, vor lauter bewusster und berechneter Anmut fast steife Haltung und sein kostbarer Frack ließen es übersehen, dass er entschieden zu fett war, vor allem in der Hüftengegend und am Hinterteil.
„Ich muss Ihnen übrigens zu Ihrem Hamlet gratulieren, mein Lieber“, sprach der Propagandaminister. „Eine famose Leistung. Die deutsche Bühne kann stolz auf sie sein.“
Höfgen neigte ein wenig das Haupt, indem er das schöne Kinn etwas nach unten drückte: Oberhalb des hohen, blendenden Kragens entstanden zahlreiche Falten am Hals. „Wer vor dem Hamlet versagt, verdient den Namen eines Schauspielers nicht.“ Seine Stimme klagte vor Bescheidenheit. Der Minister konnte eben noch konstatieren: „Sie haben die Tragödie ganz gefühlt“ – da ging ein ungeheurer Aufruhr durch den Saal.
Der Fliegergeneral und seine Gattin, die gewesene Aktrice Lotte Lindenthal, waren durch die große Mitteltüre eingetreten: Brausendes Beifallsklatschen und dröhnender Zuruf begrüßten sie. Durch ein Spalier von Menschen, aus dem Jubel stieg, schritt das erlauchte Paar. Kein Kaiser hatte jemals schöneren Einzug gehalten. Der Enthusiasmus schien ungeheuer: Jeder von den zweitausend auserlesen feinen Menschen wollte sich, den anderen und dem Ministerpräsidenten durch möglichst lautes Geschrei und Händeklatschen beweisen, einen wie glühenden Anteil er am dreiundvierzigsten Geburtstag des Hohen Herrn im besonderen und am Nationalen Staate im allgemeinen nahm. Man brüllte: „Hoch!“, „Heil!“ und: „Wir gratulieren!“ Man warf Blumen, die von Frau Lotte mit würdevoller Grazie empfangen wurden. Die Kapelle spielte großen Tusch. Der Propagandaminister bekam ein hassverzerrtes Gesicht; aber darauf achtete niemand, außer vielleicht Hendrik Höfgen. Dieser stand unbeweglich: Er erwartete seinen Gönner in zusammengenommener, anmutig steifer Haltung.
Man hatte Wetten darüber abgeschlossen, in welcher Phantasieuniform der Dicke heute abend erscheinen würde. Es war eine asketische Koketterie von ihm, nun die Gesellschaft durch den allerschlichtesten Aufzug zu verblüffen. Die flaschengrüne Litewka, die er trug, wirkte fast wie eine streng geschnittene Hausjacke. Auf der Brust blitzte ihm nur ein ganz kleiner silberner Ordensstern. In den grauen Hosen wirkten seine Beine – die er sonst gerne unter langen Mänteln verbarg – besonders umfangreich: es waren Säulen, auf denen er sich langsam dahinbewegte. Die kolossalische Größe und Breite seiner monströsen Figur waren geeignet, Schrecken und Ehrfurcht um sich zu verbreiten – zumal kein Anlass bestand, irgend etwas an ihm komisch zu finden: Dem Kühnsten verging das Lachen, wenn er erwog, wieviel Blut schon auf den Wink des Speck-und-Fleisch-Riesen geflossen war und wie unermesslich viel Blut vielleicht noch strömen würde zu seinen Ehren. Auf dem kurzen, wulstigen Hals erschien sein massives Haupt wie übergossen von dem roten Safte: das Haupt eines Cäsars[12 - Cäsar: Beiname eines Zweigs des römischen Geschlechts der Julier, auch römischer Herrscher und Thronfolger. Aus dem Namen Cäsar entstanden die Wörter Kaiser und Zar.], von dem man die Haut abgezogen hat. An diesem Gesicht war nichts Menschliches mehr: Es war aus rohem, umgeformtem Fleische ein Klotz.
Der Ministerpräsident schob seinen Bauch, dessen enorme Wölbung in die der Brust überging, majestätisch durch die strahlende Versammlung. Der Ministerpräsident grinste.
Sein Weib Lotte grinste nicht, sondern verschenkte Lächeln, eine Königin Luise in jedem Zoll. Auch ihre Robe, deren Kostbarkeit den Gesprächsstoff der Damen gebildet hatte, war einfach bei allem Pomp: glatt fließend, aus einem schimmernden Silbergewebe, endend in einer königlich langen Schleppe. Das Brillantendiadem aber in der ährenblonden Frisur, die Perlen und Smaragde auf dem Busen übertrafen an Gewicht und Strahlenglanz alles, was es sonst noch zu bewundern gab in dieser üppigen Runde. Das riesenhafte Geschmeide der Provinzschauspielerin repräsentierte Millionenwerte: Sie verdankte es der Galanterie eines Gatten, der gerne die Prunksucht und Korrumpiertheit republikanischer Minister und Bürgermeister in öffentlicher Rede geißelte, und der Treue einiger wohlsituierter und bevorzugter Untertanen. Sie galt als uneigennützig, unantastbar rein. Sie war zur Idealgestalt geworden unter den deutschen Frauen. Sie hatte große, runde, etwas hervortretende Kuhaugen von einem feuchtstrahlenden Blau; schönes blondes Haar und einen schneeweißen Busen. Übrigens war auch sie schon ein wenig zu dick – man speiste gut und reichlich im Präsidentenpalais. Man erzählte sich bewundernd von ihr, dass sie sich gelegentlich bei ihrem Gatten für Juden aus der guten Gesellschaft einsetze – die Juden kamen trotzdem ins Konzentrationslager. Man nannte sie den guten Engel des Ministerpräsidenten; indessen war der Fürchterliche nicht milder geworden, seitdem sie ihn beriet. Eine ihrer berühmtesten Rollen war die Lady Milford in Schillers „Kabale und Liebe“ gewesen: jene Matresse eines Gewaltigen, die den Glanz ihres Geschmeides und die Nähe ihres Fürsten nicht mehr erträgt, da sie erfahren hat, womit man Edelsteine bezahlt. Als sie zum letztenmal im Staatstheater auftrat, spielte sie die Minna von Barnhelm[13 - Minna von Barnhelm: die Titelrolle eines Stücks von Gotthold Ephraim Lessing (1767). „Minna von Barnhelm“ war das erste deutsche realistische Lustspiel.]: So deklamierte sie, ehe sie in den Palast des Fliegergenerals übersiedelte, noch einmal die Sätze eines Dichters, den ihr Gemahl und seine Spießgesellen hetzen und verfolgen lassen würden, lebte er heute und hier. In ihrer Gegenwart wurden die schauerlichen Geheimnisse des totalen Staates besprochen: Sie lächelte mütterlich. Morgens, wenn sie ihrem Gatten neckisch über die Schulter lugte, sah sie Todesurteile vor ihm auf dem Renaissance-schreibtisch – und er unterzeichnete sie; abends zeigte Sie den weißen Busen und die ährenblonde Kunstfrisur in Opernpremieren oder an den geschmückten Tafeln der Bevorzugten, die ihres Umgangs gewürdigt wurden. Sie war unberührbar, unangreifbar; denn sie war ahnungslos und sentimental. Sie glaubte sich umgeben von der „Liebe ihres Volkes“, weil zweitausend Ehrgeizige, Käufliche und Snobs Lärm machten zu ihren Ehren. Wie sie dahinschritt, erhobenen Hauptes, übergossen vom Licht und von der allgemeinen Bewunderung, gab es keinen Zweifel in ihrem Herzen an der Haltbarkeit solchen Zaubers. Niemals – so meinte sie zuversichtlich —, niemals würde abfallen von ihr dieser Glanz; niemals würden die Gemarterten sich rächen, niemals würde die Finsternis nach ihr greifen.
Immer noch wurde Tusch gespielt, ebenso laut wie ausführlich; immer noch dauerte das huldigende Geschrei. Inzwischen waren Lotte und ihr Dicker beim Propagandaminister und bei Höfgen angekommen. Die drei Herren hoben flüchtig die Arme, die Grußzeremonie lässig andeutend. Dann neigte Hendrik sich mit einem ernsten und innigen Lächeln über die Hand der großen Dame, die er so oft auf der Bühne hatte umarmen dürfen. – Hier standen sie, dargeboten der brennenden Neugier einer gewählten Öffentlichkeit: vier Mächtige in diesem Lande, vier Gewalthaber, vier Komödianten – der Reklamechef, der Spezialist für Todesurteile und Bombenflugzeuge, die geheiratete Sentimentale und der fahle Intrigant. Die gewählte Öffentlichkeit beobachtete, wie der Dicke dem Herrn Intendanten auf die Schulter schlug, dass es krachte, und sich mit einem grunzenden Lachen erkundigte: „Na, wie geht’s, Mephisto?“
Die Sentimentale sagte mit seelenvollem Blick zum Intendanten, für den sie eine geheime – jedoch nicht gar zu geheime – Zuneigung im Busen trug: „Ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, Hendrik, wie wunderschön ich Ihren Hamlet finde.“ Er drückte ihr schweigend die Hand, wobei er einen Schritt näher an sie herantrat und ebenso innig zu blicken versuchte, wie es ihr von der Natur gegeben war. Der Versuch musste missglücken: Seine fischigen Juwelenaugen gaben soviel sanfte Wärme nicht her. Deshalb machte er ein ernstes, beinah etwas ärgerliches, offizielles Gesicht und murmelte: „Ich muss ein paar Worte sprechen.“ Dann erhob er die Stimme. Sie hatte einen leuchtenden, raffiniert geschulten Metallton und war bis in die entferntesten Winkel des großen Saales hörbar und wirksam, als sie ausrief: „Herr Ministerpräsident! Hoheiten, Exzellenzen, meine Damen und Herren! Wir sind stolz – ja, wir sind stolz und froh, dass wir dieses Fest heute in diesem Hause mit Ihnen, Herr Ministerpräsident, und mit Ihrer wundervollen Gattin begehen dürfen…“
Mit dem ersten seiner Worte war das bewegte Gespräch der Zweitausend-Personen-Gesellschaft verstummt. In vollkommener Stille, in devoter Regungslosigkeit lauschte man der langen, pathetischen und platten Glückwunschrede, die der Intendant, Senator und Staatsrat für seinen Ministerpräsidenten hielt. Alle Augen waren auf Hendrik Höfgen gerichtet. Alle bewunderten ihn. Er gehörte zur Macht. Seine Stimme brachte, anlässlich des dreiundvierzigsten Geburtstages seines Herrn, die überraschendsten Jubeltöne hervor. Er hielt das Kinn hochgereckt, die Augen schimmerten, seine sparsamen und kühnen Gesten hatten den schönsten Schwung. Er vermied es aufs sorgsamste, ein wahres Wort zu sagen. Der skalpierte Cäsar, der Reklamechef und die Kuhäugige schienen darüber zu wachen, dass nur Lügen, nichts als Lügen von seinen Lippen kämen: Eine geheime Verabredung verlangte es so, in diesem Saale wie im ganzen Land.
Während er sich dem Ende seiner Ansprache mit bravourös gesteigertem Tempo näherte, flüsterte eine hübsche, kindlich aussehende kleine Dame – die Gattin eines bekannten Filmregisseurs —, die im Hintergrund des Raumes ein bescheidenes Plätzchen hatte, tonlos ihrer Nachbarin zu: „Wenn er fertig ist, muss ich hingehen und ihm die Hand schütteln. Ist es nicht fantastisch? Ich kenne ihn doch noch von früher – ja, wir sind in Hamburg zusammen engagiert gewesen. Das waren ulkige Zeiten! Und was hat der Mensch seitdem für eine Karriere gemacht!!“
I
H. K
In den letzten Jahren des Weltkrieges und in den ersten Jahren nach der Novemberrevolution[14 - Novemberrevolution: deutsche Revolution im November 1918. Sie begann am 30.10. mit dem Marinenaufstand in Kiel, führte am 7.11. zum Sturz der bayerischen Monarchie und am 9.11. zur Abdankung Kaiser Wilhelms II. Alle deutschen regierenden Fürsten wurden enttrohnt, in Deutschland wurde die Republik ausgerufen.] hatte das literarische Theater in Deutschland eine große Konjunktur. Um diese Zeit erging es auch dem Direktor Oskar H. Kroge glänzend, den schwierigen Wirtschaftsverhältnissen zum Trotz. Er leitete eine Kammerspielbühne in Frankfurt am Main. In dem engen, stimmungsvoll intimen Kellerraum traf sich die intellektuelle Gesellschaft der Stadt und vor allem eine angeregte, von den Ereignissen aufgewühlte, diskussions- und beifallsfreudige Jugend, wenn es die Neuinszenierung eines Stückes von Wedekind[15 - Wedekind, Frank (
1864, †1918), deutscher Dichter, satirischer Dramatiker, suchte die konventionelle bürgerliche Moral als Unmoral zu enthüllen.] oder Strindberg[16 - Strindberg, August (
1849, †1912), schwedischer Dichter; nahm den Weg vom Naturalismus über den Individualismus zur Mystik; gestaltete den Kampf der Geschlechter und die seelische Zerrissenheit.] gab oder eine Uraufführung von Georg Kaiser[17 - Kaiser, Friedrich Carl Georg (
1878, † 1945), der erfolgreichste Dramatiker der expressionistischen Generation. Aus seinem Wirken als Autor gingen 60 Dramen hervor, von denen aber viele in Vergessenheit geraten sind.], Sternheim[18 - Sternheim, Carl (
1878, †1942), deutscher Dramatiker; schrieb satirische Komödien.], Fritz von Unruh[19 - Unruh, Fritz von (
1885, †1970), deutscher Schriftsteller; Pazifist.], Hasenclever[20 - Hasenclever, Walter (
1890, †1940), deutscher Dichter; schrieb expressionistische Dramen, Lustspiele, Lyrik.] oder Toller[21 - Toller, Ernst (
1893, †1939), deutscher Schriftsteller; 1919 Mitglied der Münchener Räteregierung; Pazifist, emigrierte 1933 in die USA.]. Oskar H. Kroge, der selbst Essays und hymnische ‘Gedichte’ schrieb, empfand das Theater als die moralische Anstalt: von der Schaubühne sollte eine neue Generation erzogen werden zu den Idealen, von denen man damals glaubte, dass die Stunde ihrer Erfüllung gekommen sei – zu den Idealen der Freiheit, der Gerechtigkeit, des Friedens. Oskar H. Kroge war pathetisch, zuversichtlich und naiv. Am Sonntagvormittag, vor der Aufführung eines Stückes von Tolstoi oder von Rabindranath Tagore[22 - Tagore, Rabindranath (
1861, †1941), indischer Dichter, Philosoph; schrieb in Bengali und Englisch Romane, Dramen und Gedichte. Nobelpreis für Literatur 1913.], hielt er eine Ansprache an seine Gemeinde. Das Wort „Menschheit“ kam häufig vor; den jungen Leuten, die sich im Stehparkett drängten, rief er mit bewegter Stimme zu: „Habet den Mut zu euch selbst, meine Brüder!“ – und er erntete Beifallsstürme, da er mit den Schillerworten schloss: „Seid umschlungen, Millionen!“
Oskar H. Kroge war sehr beliebt und angesehen in Frankfurt am Main und überall dort im Lande, wo man an den kühnen Experimenten eines geistigen Theaters Anteil nahm. Sein ausdrucksvolles Gesicht mit der hohen, zerfurchten Stirn, der schütteren, grauen Haarmähne und den gutmütigen, gescheiten Augen hinter der Brille mit schmalen Goldrand war häufig zu sehen in den kleinen Revuen der Avantgarde; zuweilen sogar in den großen Illustrierten. Oskar H. Kroge gehörte zu den aktivsten und erfolgreichsten Vorkämpfern des dramatischen Expressionismus.
Es war ohne Frage ein Fehler von ihm gewesen – nur zu bald sollte es ihm klarwerden – sein stimmungsvolles kleines Haus in Frankfurt aufzugeben. Das Hamburger Künstlertheater, dessen Direktion man ihm im Jahre 1923 anbot, war freilich größer. Deshalb akzeptierte er. Das Hamburger Publikum aber erwies sich als längst nicht so zugänglich dem leidenschaftlichen und anspruchsvollen Experiment wie jener zugleich routinierte und enthusiastische Kreis, der den Frankfurter Kammerspielen treu gewesen war. Im Hamburger Künstlertheater musste Kroge, außer den Dingen, die ihm am Herzen lagen, immer noch den „Raub der Sabinerinnen“[23 - „Raub der Sabinerinnen“: eine Komödie von Franz] und „Pension Schöller“[24 - „Pension Schöller“: ein Lustspiel von Wilhelm Jacobi und Carl Laufs. Die Uraufführung fand am 7. Oktober 1890 in Berlin statt.] zeigen. Darunter litt er. Jeden Freitag, wenn der Spielplan für die kommende Woche festgesetzt wurde, gab es einen kleinen Kampf mit Herrn Schmilz, dem geschäftlichen Leiter des Hauses. Schmilz wollte die Possen und Reißer angesetzt haben, weil sie Zugstücke waren; Kroge aber bestand auf dem literarischen Repertoire. Meistens musste Schmilz, der übrigens eine herzliche Freundschaft und Bewunderung für Kroge hatte, nachgeben. Das Künstlertheater blieb literarisch – was seinen Einnahmen schädlich war.
Kroge klagte über die Indifferenz der Hamburger Jugend im besonderen und über die Ungeistigkeit einer Öffentlichkeit im allgemeinen, und Paul von Schönthan, in der es um ein Theaterstück geht, das Gymnasialprofessor Gollwitz als Student geschrieben hat – eine Jugendsünde, wie er es nennt. die sich allem Höheren entfremdet habe. „Wie schnell es gegangen ist!“ stellte er mit Bitterkeit fest. „Im Jahre 1919 lief man noch zu Strindberg und Wedekind; 1926 will man nur mehr Operetten.“ Oskar H. Kroge war anspruchsvoll und übrigens ohne prophetischen Geist. Hätte er sich beschwert über das Jahr 1926, wenn er sich hätte vorstellen können, wie das Jahr 1936 aussehen würde? – „Nichts Besseres zieht mehr“, grollte er noch. „Sogar bei den Webern[25 - „Die Weber“: ein soziales Drama in fünf Akten von Gerhart Hauptmann, das am 26. Februar 1893 im neuen Theater Berlin privat und am 25. September 1894 im Deutschen Theater Berlin öffentlich uraufgeführt wurde. Es behandelt den Weberaufstand von 1844.] gestern ist das Haus halb leer gewesen.“
„Immerhin kommen wir doch zur Not noch auf unsere Rechnung.“ Direktor Schmilz bemühte sich, den Freund zu trösten: „Aber wie!“ Kroge wollte sich durchaus nicht trösten lassen. „Aber wie kommen wir denn auf unsere Rechnung! Berühmte Gäste aus Berlin müssen wir uns einladen – so wie heute abend —, damit die Hamburger ins Theater gehen.“
Hedda von Herzfeld – Kroges alle Mitarbeiterin und Freundin, die schon in Frankfurt Dramaturgin und Schauspielerin bei ihm gewesen war – bemerkte: „Du siehst wieder mal alles schwarz in schwarz, Oskar H.! Es ist ja schließlich keine Schande, Dora Martin gastieren zu lassen – sie ist wundervoll —, und übrigens kommen unsere Hamburger auch, wenn Höfgen spielt.“ Während sie Höfgens Namen aussprach, lächelte Frau von Herzfeld klug und zärtlich. Über ihr großes, matt gepudertes Gesicht mit der fleischigen Nase, den großen, goldbraunen, wehmütig intelligenten Augen ging ein bescheidenes Aufleuchten.
Kroge sagte brummig: „Höfgen wird überzahlt.“
„Die Martin übrigens auch“, fügte Schmilz hinzu. „Ihren ganzen Zauber in Ehren und zugegeben, dass sie ungeheuer zieht: aber tausend Mark Abendgage, das ist doch wohl ein bisschen toll.“
„Berliner Staransprüche“, machte Hedda spöttisch. Sie hatte in Berlin nie zu tun gehabt und behauptele, den Betrieb der Hauptstadt zu verachten.
„Tausend Mark im Monat für Höfgen ist auch übertrieben“, behauptete Kroge, plötzlich gereizt. „Seit wann hat er denn eigentlich tausend?“ fragte er herausfordernd Schmilz. „Es sind doch immer nur achthundert gewesen, und das war reichlich genug.“
„Was soll ich machen?“ Schmilz entschuldigte sich. „Er ist zu mir ins Büro gesprungen, und er hat sich mir auf den Schoß gesetzt.“ Frau von Herzfeld konnte mit Belustigung feststellen, dass Schmilz etwas rot wurde, während er dies erzählte. „Er hat mich am Kinn gekitzelt und hat immer wieder gesagt: ,Tausend Mark müssen es sein! Tausend, Direktorchen! Es ist eine so schöne runde Summe!’ Was sollte ich da machen, Kroge? Sagen Sie selbst!“
Es war Höfgens schlaue Gewohnheit, wie ein nervöser kleiner Sturmwind in Schmitzens Büro zu fahren, wenn er Vorschuss oder Gagenerhöhung wollte. Zu solchen Anlässen spielte er den übermütig Launischen und Kapriziösen, und er wusste, dass der ungeschickte dicke Schmilz verloren war, wenn er ihm die Haare zauste und den Zeigefinger munter in den Bauch stieß. Da es sich um die Tausend-Mark-Gage handelte, hatte er sich ihm sogar auf den Schoß gesetzt: Schmilz gestand es unter Erröten.
„Das sind Albernheiten!“ Kroge schüttelte ärgerlich das versorgte Haupt. „Überhaupt ist Höfgen ein grundalberner Mensch. Alles an ihm ist falsch, von seinem literarischen Geschmack bis zu seinem sogenannten Kommunismus. Er ist kein Künstler, sondern ein Komödiant.“
„Was hast du gegen unseren Hendrik?“ Frau von Herzfeld zwang sich zu einem ironischen Ton; in Wahrheit war ihr keineswegs nach Ironie zumute, wenn sie von Höfgen sprach, für dessen geübte Reize sie nur zu empfänglich war, „Er ist unser bestes Stück. Wir können froh sein, wenn wir ihn nicht an Berlin verlieren.“
„Ich bin gar nicht so besonders stolz auf ihn“, sagte Kroge. „Er ist doch nicht mehr als ein routinierter Provinzschauspieler, und das weiß er übrigens im Grunde selbst ganz genau.“
Schmilz fragte: „Wo steckt er denn heute abend?“ – worauf Frau von Herzfeld leise durch die Nase lachte: „Er hat sich in seiner Garderobe hinter einem Paravent versteckt – der kleine Bock hat es mir erzählt. Er ist immer furchtbar aufgeregt und eifersüchtig, wenn Berliner Gäste da sind. So weit wie die werde er es niemals bringen, sagt er dann – und versteckt sich hinter einem Paravent, vor lauter Hysterie. Die Martin bringt ihn wohl besonders aus der Fassung, das ist so eine Art von Hassliebe bei ihm. Heute abend soll er schon einen Weinkrampf gehabt haben.“
„Da seht ihr seinen Minderwertigkeitskomplex!“ rief Kroge und schaute triumphierend um sich. „Oder vielmehr: dass er im Grunde irgendwo die richtige Einschätzung hat für sich selber.“
Die drei saßen in der Theaterkantine, die, nach den Initialen des Hamburger Künstlertheaters, kurz „H. K.“ genannt wurde.
Drunten, im Theater, spielte Dora Martin, die mit ihrer heiseren Stimme, der verführerischen Magerkeit des ephebischen Körpers und den tragisch weiten, kindlichen und unergründlichen Augen das Publikum der großen deutschen Städte verhexte, einen Reißer zu Ende. Die beiden Direktoren und Frau von Herzfeld hatten nach dem zweiten Akt ihre Loge verlassen. Die übrigen Mitglieder des Künstlertheaters waren im Saal geblieben, um der Berliner Kollegin, die sie halb bewunderten und halb hassten, bis zum Schluss zuzusehen.
„Das Ensemble, das sie sich mitgebracht hat, ist ja wirklich unter jeder Kritik“, stellte Kroge verächtlich fest.
„Was wollen Sie?“ meinte Schmilz. „Wie soll sie jeden Abend ihre tausend Mark verdienen, wenn sie sich auch noch teure Leute mit auf die Reise nimmt?“
„Aber sie selber wird immer besser“, sagte die kluge Herzfeld. „Sie kann sich jede Manieriertheit leisten. Sie kann wie ein geisteskrankes Baby sprechen: Sie bezwingt.“
„Geisteskrankes Baby ist nicht schlecht“, lachte Kroge. „Man scheint unten fertig zu sein“, fügte er hinzu, mit einem Blick durchs Fenster. Die Leute kamen den gepflasterten Weg herauf, der vom Theater, an der Kantine vorbei, zu dem Tor führte, durch das man auf die Straße trat.
Nach und nach füllte sich die Kantine. Die Schauspieler grüßten mit einer respektvoll betonten Herzlichkeit den Direktorentisch und riefen dem Wirt, einem gedrungenen, kräftigen Greise mit weißem Knebelbart und blauroter Nase, kleine Scherze zu. Väterchen Hansemann, der Kantinenbesitzer, war für das Ensemble eine beinah ebenso bedeutungsvolle Persönlichkeit wie Schmilz, der geschäftliche Direktor. Von Schmilz konnte man Vorschuss bekommen, wenn er sich gerade in gnädiger Laune befand; bei Hansemann aber musste man anschreiben lassen, wenn in der zweiten Monatshälfte die Gage aufgebraucht und ein Vorschuss nicht genehmigt worden war. Alle standen bei ihm in der Kreide; man behauptete, dass Höfgen ihm mehr als hundert Mark schuldig war.
Alle sprachen über Dora Martin, jeder hatte seine eigene Ansicht über den Rang ihrer Leistung; nur darüber, dass sie entschieden zuviel Geld verdiente, waren alle sich einig.
Die Motz erklärte: „An dieser Starwirtschaft geht das deutsche Theater zugrunde“ – wozu ihr Freund Petersen grimmig nickte. Petersen war Väterspieler mit dem Ehrgeiz zum Heroischen; er bevorzugte Könige oder adlige alte Haudegen in historischen Stücken. Leider war er etwas zu klein und dick für diese Partien – was er auszugleichen suchte durch eine stramme und kampfeslustige Haltung. Zu seinem Gesicht, das den Ausdruck falscher Biederkeit zeigte, hätte ein grauer Schifferbart gepasst; da er fehlte, wirkte seine Miene ein wenig kahl, mit der langen, rasierten Oberlippe und den sehr blauen, ausdrucksvoll blitzenden, zu kleinen Augen. Die Motz liebte ihn mehr als er sie: das wussten alle. Da er genickt hatte, wandte sie sich nun direkt an ihn, um in einem intimen und bedeutungsvollen Ton zu sagen: „Nicht wahr, Petersen: über diese Misswirtschaft haben wir schon häufig miteinander gesprochen?“ Er bestätigte treuherzig: „Gewiss doch, Frau!“ und blinzelte Rahel Mohrenwitz zu, die aufgemacht war als das perverse und dämonische junge Mädchen: mit schwarzen Ponys bis zu den rasierten Augenbrauen und einem großen, schwarzgerandeten Monokel im Gesicht, das übrigens kindlich, pausbäckig und völlig ungeformt war.
„In Berlin wirken die Martinschen Mätzchen vielleicht“, sprach die Motz resolut. „Aber unsereinem kann sie nichts vormachen, wir sind schließlich lauter alte Theaterhasen.“ Sie blickte beifallheischend um sich. Ihr Fach war die komische Alte; zuweilen durfte sie auch reife Salon-damen spielen. Sie lachte gern, viel und laut, wobei sie scharfe Falten um den Mund bekam, in dessen Innerem Gold funkelte. Im Augenblick freilich zeigte sie eine würdevoll ernste, beinah zornige Miene.
Rahel Mohrenwitz sagte, wobei sie hochmütig mit ihrer langen Zigarettenspitze spielte: „Niemand kann schließlich leugnen, dass die Martin irgendwo eine enorm starke Persönlichkeit ist. Was sie auf der Bühne auch macht: immer ist sie unerhört intensiv da – ihr versteht, was ich meine…“ Alle verstanden es; die Motz aber schüttelte missbilligend den Kopf, während die kleine Angelika Siebert mit ihrem hohen, schüchternen Stimmchen erklärte: „Ich bewundere die Martin. Es geht eine zauberhafte Kraft von ihr aus, finde ich…“ Sie wurde sehr rot, weil sie einen so langen und gewagten Satz vorgebracht hatte. Alle sahen mit einer gewissen Rührung zu ihr hin. Die kleine Siebert war reizend. Ihr Köpfchen mit dem kurzgeschnittenen, links gescheitelten blonden Haar glich dem eines dreizehnjährigen Buben. Ihre hellen und unschuldigen Augen wurden dadurch nicht weniger anziehend, dass sie kurzsichtig waren: manche fanden, dass gerade die Art, auf die Angelika beim Schauen die Augen zusammenkniff, ihren besonderen Charme ausmache.
„Unsere Kleine schwärmt wieder einmal“, sagte der schöne Rolf Bonetti und lachte etwas zu laut. Er war jenes Mitglied des Ensembles, das die meisten Liebesbriefe aus dem Publikum erhielt: daher sein stolzer, müder, vor lauter Blasiertheit beinah angewiderter Gesichtsausdruck. Der kleinen Angelika gegenüber jedoch war er der Werbende: schon seit längerem bemühte er sich um sie. Auf der Bühne durfte er sie oft in den Armen halten, das brachte sein Rollenfach mit sich. Im übrigen aber blieb sie spröde. Mit einer wunderlichen Hartnäckigkeit verschenkte sie ihre Zärtlichkeit nur dorthin, wo nicht die mindeste Aussicht bestand, dass man sie erwiderte oder auch nur wünschte. Rührend und begehrenswert, wie sie war, schien sie ganz dafür gemacht, viel geliebt und sehr verwöhnt zu werden. Der sonderbare Eigensinn ihres Herzens aber ließ sie kühl und spöttisch bleiben vor Rolf Bonettis stürmischen Beteuerungen, und ließ sie bitterlich weinen über die eisige Geringschätzung, die Hendrik Höfgen ihr gegenüber an den Tag legte.
Rolf Bonetti sagte kennerhaft: „Als Frau kommt diese Martin jedenfalls gar nicht in Frage: ein unheimlicher Zwitter – sicher hat sie so etwas wie Fischblut in den Adern.“
„Ich finde sie schön“, sagte Angelika, leise aber entschlossen. „Sie ist die schönste Frau, finde ich.“ Schon standen ihr die Augen voll Tränen: Angelika weinte häufig, auch ohne besonderen Anlass. Träumerisch sagte sie noch: „Es ist merkwürdig – ich spüre irgendeine geheimnisvolle Ähnlichkeit zwischen Dora Martin und Hendrik…“ Dies erregte allgemeine Verwunderung.
„Die Martin ist eine Jüdin.“ Es war der junge Hans Miklas, der sich unvermittelt so vernehmen ließ. Alle schauten betroffen und etwas angewidert zu ihm hin. – „Der Miklas ist köstlich“, sprach die Motz in ein betretenes Schweigen hinein und versuchte zu lachen. Kruge runzelte die Stirne, verwundert und degoutiert, während Frau von Herzfeld nur den Kopf schütteln konnte; übrigens war sie blass geworden. Da die Pause lang und peinlich wurde – der junge Miklas stand bleich und trotzig an die Theke gelehnt —, sagte Direktor Kruge schließlich ziemlich scharf: „Was soll denn das?“ und machte ein Gesicht, so böse, wie es ihm eben möglich war. Ein anderer junger Schauspieler, der sich bis dahin leise mit Vater Hansemann unterhalten hatte, sagte forsch und versöhnlich: „Hoppla, das ist danebengegangen! Lass nur, Miklas, so was kann vorkommen, du bist sonst ein ganz braves Kind!“ Dabei klopfte er dem Übeltäter auf die Schulter und lachte so herzlich, dass alle einstimmen konnten; sogar Kroge entschloss sich zu einer Heiterkeit, die freilich krampfhaften Charakter hatte: er schlug sich, mit der flachen Hand auf den Schenkel und warf den Oberkörper nach vorne, so heftig schien er sich plötzlich zu amüsieren. Miklas aber blieb ernst; er drehte das verstockte, bleiche Gesicht zur Seite, die Lippen böse aufeinandergepresst. „Sie ist doch eine Jüdin.“ Er sprach so leise, dass fast niemand es hören konnte; nur Otto Ulrichs, der gerade erst durch seine Unbefangenheit die Situation gerettet hatte, hörte es, und nun strafte er ihn mit einem ernsten Blick.
Nachdem Direktor Kroge durch sein Gelächter ausführlich bekundet hatte, dass er die Entgleisung des jungen Miklas durchaus von der komischen Seite nahm, winkte er Ulrichs. „Ach, Ulrichs, kommen Sie doch bitte mal einen Augenblick!“ Ulrichs setzte sich an den Tisch zu den Direktoren und Frau von Herzfeld.
„Ich will mich nicht in Ihre Angelegenheiten mischen, wirklich nicht.“ Kroge ließ es sich anmerken, dass die Sache ihm äußerst peinlich war. „Aber es kommt jetzt immer häufiger vor, dass Sie in kommunistischen Versammlungen auftreten. Gestern haben Sie schon wieder irgendwo mitgemacht. Das schadet Ihnen doch, Ulrichs, und uns schadet es auch.“ Kroge sprach leise. „Sie wissen doch, wie die bürgerlichen Zeitungen sind, Ulrichs“, sagte er eindringlich. „Suspekt sind wir den Leviten[26 - Leviten, A.T.: die Tempeldiener aus dem Stamm Levi.] ohnedies. Wenn eines unserer Mitglieder sich nun politisch exponiert – es kann verhängnisvoll für uns sein, Ulrichs.“ Kroge trank sehr hastig seinen Kognak aus, er war sogar etwas rot geworden.
Ulrichs antwortete ruhig; „Es ist mir sehr erwünscht, Herr Direktor, dass Sie von diesen Dingen zu mir sprechen. Natürlich habe ich auch schon über sie nachgedacht. Vielleicht ist es besser, wir trennen uns, Herr Direktor – glauben Sie mir, dass es mir nicht leichtfällt, diesen Vorschlag zu machen. Aber auf meine politische Betätigung kann ich nicht verzichten. Ihr müsste ich sogar mein Engagement opfern, und das wäre ein Opfer; denn ich bin gerne hier.“ Er sprach mit einer angenehmen, dunklen und warmen Stimme. Während er redete, schaute Kroge mit einer väterlichen Sympathie auf sein intelligentes, kraftvolles Gesicht. Otto Ulrichs war ein gut aussehender Mann. Seine hohe, freundliche Stirn, von der das schwarze Haar weit zurückwich, und die engen, dunkelbraunen, gescheiten und lustigen Augen flößten Vertrauen ein. Kroge mochte ihn sehr. Deshalb wurde er jetzt beinahe zornig.
„Aber Ulrichs!“ rief er aus. „Davon kann doch gar keine Rede sein. Sie wissen ganz genau, dass ich Sie niemals fortlassen würde!“
„Wir können Sie gar nicht entbehren!“ fügte Schmilz hinzu – der dicke Mensch überraschte zuweilen durch eine merkwürdig vibrierende, helle und hübsche Stimme —; wozu die Herzfeld ernst bestätigend nickte.
„Es ist doch nur ein klein bisschen Zurückhaltung, worum ich Sie bitte“, versicherte Kroge.
Ulrichs sagte mit Herzlichkeit: „Ihr seid alle sehr nett zu mir – wirklich sehr nett – und ich werde mir Mühe geben, dass ich euch nicht gar zu sehr kompromittiere.“ Die Herzfeld lächelte ihm vertraulich zu. „Es ist Ihnen ja wohl nicht ganz unbekannt“, sagte sie leise, „dass wir politisch weitgehend mit Ihnen sympathisieren.“ – Der Mann, mit dem sie in Frankfurt verheiratet gewesen war und dessen Namen sie führte, war Kommunist. Er war viel jünger als sie und hatte sie verlassen. Zur Zeit arbeitete er in Moskau als Filmregisseur.
„Weitgehend!“ betonte Kroge mit lehrhaft erhobenem Zeigefinger. „Wenngleich nicht ganz, nicht in allen Stücken. Nicht alle unsere Träume haben sich in Moskau erfüllt. Können die Träume, die Forderungen, die Hoffnungen der Geistigen sich erfüllen unter der Diktatur?“
Ulrichs antwortete ernst, wobei seine engen Augen noch schmaler wurden und einen beinahe drohenden Blick bekamen: „Nicht nur die Geistigen – oder die, welche sich so nennen – haben ihre Hoffnungen und Forderungen. Noch dringlicher sind die Forderungen des Proletariats. Diese waren, so wie die Welt heute ist, nur zu erfüllen mittels der Diktatur.“ Hier zeigte Direktor Schmilz ein bestürztes Gesicht. Ulrichs, um dem Gespräch eine leichtere Wendung zu geben, sagte lächelnd: „Übrigens wäre auf der Versammlung gestern das Künstlertheater beinah durch sein prominentestes Mitglied repräsentiert worden. Hendrik wollte eigentlich auftreten – im letzten Augenblick ist er dann leider verhindert gewesen.“
„Höfgen wird immer im letzten Augenblick verhindert sein, wenn es sich um Angelegenheiten handelt, die bedenklich für seine Karriere werden könnten.“ Kroge hatte verächtlich den Mund verzogen, während er dies sagte. Hedda von Herzfeld sah ihn flehend und kummervoll an. Als aber Otto Ulrichs mit Überzeugung äußerte: „Hendrik gehört zu uns“, wiederholte Ulrichs. „Und er wird das durch die Tat beweisen. Seine Tat wird das Revolutionäre Theater sein. In diesem Monat soll es eröffnet werden.“
„Noch ist es nicht eröffnet.“ Kroge lächelte boshaft. „Zunächst ist nur das Briefpapier da, mit der schönen Überschrift ‘Revolutionäres Theater’. Nehmen wir aber sogar einmal an, es kommt zur Eröffnung: Glauben Sie, Höfgen wird sich heraustrauen mit einem wirklich revolutionären Stück?“
Ziemlich heftig erwiderte Ulrichs: „In der Tat glaube ich das! Übrigens ist das Stück ja schon ausgesucht – man kann wohl sagen, dass es ein revolutionäres ist.“
Kroge machte, mit der Miene und Gebärde eines müden und verächtlichen Zweifels: „Wir werden ja sehen.“ Hedda von Herzfeld, die bemerkte, dass Ulrichs rot wurde vor Ärger, fand es geraten, nunmehr das Thema zu wechseln.
„Was war das eigentlich vorhin für eine fantastische kleine Äußerung von diesem Miklas? Stimmt es also doch, dass der Bursche Antisemit ist und mit den Nationalsozialisten zu tun hat?“ Bei dem Wort „Nationalsozialisten“ verzerrte sich ihr Gesicht vor Ekel, als hätte sie eine tote Ratte berührt. Schmilz lachte verächtlich, während Kroge sagte: „So einen können wir gerade gebrauchen!“ Ulrichs versicherte sich durch einen Seitenblick, dass Miklas ihnen nicht zuhörte, ehe er mit gedämpfter Stimme erklärte:
„Hans ist im Grunde ein guter Kerl – ich weiß das, denn ich habe mich oft mit ihm unterhalten. Mit so einem Jungen muss man sich viel und nachsichtig beschäftigen – dann gewinnt man ihn vielleicht noch für die gute Sache. Ich glaube nicht, dass er für uns schon ganz verloren ist. Seine Aufsässigkeit, seine allgemeine Unzufriedenheit sind falsch gelandet – verstehen Sie, was ich meine?“ Frau Hedda nickte; Ulrichs flüsterte eifrig: „In so einem jungen Kopf ist alles wirr, alles ungeklärt – es laufen ja heute Millionen herum wie dieser Miklas. Bei denen gibt es vor allem einen Hass, und der ist gut, denn er gilt dem Bestehenden. Aber dann hat so ein Bursche Pech und fällt den Verführern in die Hände, und die verderben seinen guten Hass. Sie erzählen ihm, an allem Übel seien die Juden schuld, und der Vertrag von Versailles[27 - der Vertrag von Versailles: der am 28.6.1919 in Versailles von den Ententemächten und dem Deutschen Reich zur Beendigung des ersten Weltkrieges unterzeichnete Friedensvertrag.], und er glaubt den Dreck und vergisst, wer eigentlich die Schuldigen sind, hier und überall. Das ist das berühmte Ablenkungsmanöver, und bei all diesen jungen Wirrköpfen, die nichts wissen und nicht richtig nachdenken können, hat es Erfolg. Da sitzt dann so ein Häufchen Unglück und lässt sich Nationalsozialist schimpfen!“
Sie schauten alle vier zu Hans Miklas hin, der an einem kleinen Tisch in der entferntesten Ecke des Raumes, bei der dicken alten Souffleuse, Frau Efeu, bei Willi Bock, dem kleinen Garderobier, und bei dem Bühnenportier, Herrn Knurr, Platz genommen hatte. Von Herrn Knurr wurde behauptet, dass er ein Hakenkreuz unter dem Rockaufschlag versteckt trage und dass seine Privatwohnung voll sei von den Bildern des nationalsozialistischen „Führers“, die er in der Portiersloge denn doch nicht aufzuhängen wagte. Herr Knurr hatte heftige Diskussionen und Streitigkeiten mit den kommunistischen Bühnenarbeitern, die ihrerseits nicht im H. K. verkehrten, sondern ihren eigenen Stammtisch in einer Kneipe gegenüber hatten – wo sie zuweilen von Ulrichs besucht wurden. Höfgen wagte sich beinah nie an den Stammtisch der Arbeiter; er fürchtete, die Männer würden über sein Monokel lachen. Andererseits pflegte er zu klagen, das H. K. sei ihm durch die Anwesenheit des nationalistischen Herrn Knurr ganz verleidet. „Dieser verfluchte Kleinbürger“, sagte Höfgen von ihm, „der auf seinen Führer und Erlöser wartet wie die Jungfer auf den Kerl, der sie schwängern soll! Mir wird immer heiß und kalt, wenn ich an der Portiersloge vorbeigehen muss und an das Hakenkreuz unter seinem Rockaufschlag denke…“
„Natürlich hat er eine ekelhafte Kindheit gehabt“, sagte Otto Ulrichs, der noch bei Hans Miklas war. „Er hat mir einmal davon erzählt. Aufgewachsen ist er in irgend so einem finsteren niederbayrischen Nest. Der Vater ist im Weltkrieg gefallen, die Mutter scheint eine aufgeregte, unvernünftige Person zu sein; machte den verrücktesten Krach, als der Junge zum Theater gehen wollte – man kann sich das ja alles vorstellen. Er ist ehrgeizig, fleißig, auch begabt; er hat enorm viel gelernt, mehr als die meisten von uns. Ursprünglich wollte er Musiker werden, er hat den Kontrapunkt gelernt, und er kann Klavier spielen, und er kann Akrobatik und Steptanzen und Ziehharmonika und überhaupt alles. Er arbeitet den ganzen Tag, dabei ist er wahrscheinlich krank, sein Husten klingt scheußlich. Natürlich findet er, dass er zurückgesetzt wird und nicht genügend Erfolg hat, und schlechte Rollen. Er glaubt, wir sind verschworen gegen ihn, von wegen seiner so-genannten politischen Gesinnung.“ Ulrichs schaute noch immer, aufmerksam und ernst, zum jungen Miklas hinüber. „95 Mark Monatsgehalt“, sagte er plötzlich und blickte drohend auf Direktor Schmilz, der sofort unruhig auf seinem Stuhl zu rücken begann, „es ist schwer, dabei ein anständiger Mensch zu bleiben.“ Nun schaute auch die Herzfeld aufmerksam zu Miklas hinüber.
Zum Garderobier Bock, zur Souffleuse Efeu und Herrn Knurr pflegte Hans Miklas sich stets dann zu setzen, wenn er sich recht niederträchtig benachteiligt fand von der Direktion des Künstlertheaters, die er vor seinen politischen Freunden als „verjudet“ und „marxistisch“ bezeichnete. Vor allem hasste er Höfgen, diesen „ekelhaften Salonkommunisten“. Höfgen war, wenn man Miklas glauben durfte, eifersüchtig und eitel; Höfgen war größenwahnsinnig und wollte alles spielen, besonders aber spielte er ihm, Miklas, die Rollen weg. „Es ist eine Gemeinheit, dass er mir den Moritz Stiefel nicht gelassen hat“, äußerte der Verbitterte. Miklas schaute zornig auf seine eigenen Beine, die mager und sehnig waren.
Garderobier Bock, ein dummer Bursche mit wässrigen Augen und sehr blonden, sehr harten Haaren, die er kurz geschoren wie eine Bürste trug, kicherte über seinem Bierglas: niemand wusste, ob über Hendrik Höfgen, der als Gymnasiast komisch aussehen würde, oder über den machtlosen Zorn des jungen Hans Miklas. Die Souffleuse Efeu hingegen zeigte Entrüstung; sie bestätigte Miklas, dass es eine Gemeinheit sei. Das mütterliche Interesse, das die dicke alte Person an dem jungen Menschen nahm, brachte für diesen praktische Vorteile mit sich. Übrigens sympathisierte sie auch politisch mit ihm. Sie stopfte ihm seine Socken, lud ihn zum Abendessen ein; schenkte ihm Wurst, Schinken und Eingemachtes. „Damit du dicker wirst, Junge“, sagte sie und schaute ihn zärtlich an. Dabei gefiel ihr gerade die Magerkeit seines trainierten, nicht sehr großen, elastischen, schmalen Körpers. Wenn sein dichtes dunkelblondes Haar am Hinterkopf gar zu widerspenstig in die Höhe stand, sagte die Efeu: „Du siehst aus wie ein Gassenjunge!“ und holte einen Kamm aus dem Beutel.
Wie ein Gassenjunge sah Hans Miklas wirklich aus, freilich wie einer, dem es nicht besonders gut geht und der seine Angegriffenheit trotzig bezwingt. Sein Leben war anstrengend; er trainierte den ganzen Tag, mutete seinem schmalen Körper vieles zu, wahrscheinlich kamen daher seine Reizbarkeit und der finster abweisende Ausdruck seines jungen Gesichtes. Dieses Gesicht hatte üble Farben; unter den starken Backenknochen gab es schwarze Löcher, so eingefallen waren die Wangen. Um die hellen Augen waren die Ränder auch beinah schwarz. Hingegen war die reine, kindliche Stirne wie beschienen von einer bleichen und empfindlichen Helligkeit; auch der Mund leuchtete, aber auf ungesunde Art, viel zu rot; in den abweisend vorgeschobenen Lippen schien sich alles Blut zu sammeln, von dem das Gesicht sonst leer war. Unter den starken und verführerischen Lippen, von denen die Souffleuse Efeu oft den Blick nicht lassen konnte, enttäuschte das zu kurze, schwächlich abfallende Kinn.
„Heute früh, auf der Probe, hast du wieder ganz zum Fürchten ausgesehen“, sprach die Efeu besorgt. „So schwarze, tiefe Löcher in den Backen! Und der Husten! Dumpf hat der geklungen – zum Erbarmen!“
Miklas konnte es nicht ausstehen, wenn man ihn bemitleidete; nur die Gaben, in die solches Mitleid sich umsetzte, nahm er gerne, wenngleich wortkarg entgegen. Das klagende Gerede der Efeu überhörte er einfach. Hingegen wollte er von Bock wissen: „Stimmt es, dass der Höfgen sich heute den ganzen Abend in seiner Garderobe hinter dem Paravent versteckt hat?“
Bock konnte es nicht in Abrede stellen. Miklas fand Höfgens Betragen derartig albern, dass es ihn geradezu in Heiterkeit versetzte, „Ich sage doch, ein kompletter Narr!“ Dabei lachte er triumphierend. „Und das alles wegen einer Jüdin, der der Kopf bis dahin zwischen den Schultern steckt!“ Er machte sich bucklig, um anzudeuten, wie die Martin aussehe: die Efeu amüsierte sich herzlich. „Und so etwas will ein Star sein!“ Mit seinem höhnischen Ausruf konnte er ebensowohl die Martin meinen wie Höfgen. Beide gehörten, nach seinem Urteil, in dieselbe bevorzugte, undeutsche, tief verwerfliche Clique. „Die Martin!“ redete er weiter, das böse, leidende, reizvolle junge Gesicht in die mageren, nicht ganz sauberen Hände gestützt. „Sie soll ja auch immer diese salonkommunistischen Phrasen dreschen, mit ihren tausend Mark jeden Abend. Eine Bande ist das! Aber es wird aufgeräumt werden mit denen – der Höfgen wird auch noch dran glauben müssen!“
Das enge Lokal war voll Rauch. „Die Luft ist ja dick zum Schneiden“, klagte die Motz. „Das hält doch der stärkste Mann nicht aus. Und meine Stimme! Kinder, morgen könnt ihr mich wieder beim Halsarzt sitzen sehen.“ Niemand hatte Lust, sie sitzen zu sehen. Rahel Mohrenwitz machte sogar ironisch: „Huch, unsere Koloratursängerin!“ – wofür sie einen fürchterlichen Blick von der Motz bekam, die sowieso etwas gegen Rahel hatte: Petersen wusste, warum. Erst gestern wieder hatte man ihn in der Garderobe des dämonischen Mädchens gefunden, und die Motz hatte weinen müssen. Heute aber schien sie entschlossen, sich keinesfalls die Stimmung verderben zu lassen von einer dummen Gans, die sich vielleicht auf ihr Monokel und ihre lächerliche Frisur noch was einbildete. Vielmehr faltete sie die Hände vor dem Bauch und markierte gemütliche Stimmung. „Aber nett ist es hier“, sagte sie herzlich. „Was, Vater Hansemann?“ Sie blinzelte dem Wirt zu, dem sie noch 27 Mark schuldete und der deshalb nicht zurückblinzelte. Gleich danach entsetzte sie sich, weil Petersen sich ein Beefsteak servieren ließ, noch dazu mit Spiegelei. „Als ob ein Paar Würstchen nicht genügt hätten!“ Ihr standen Tränen des Zorns in den Augen. Zwischen Motz und Petersen gab es viel Streit und Hader, weil der Väterspieler, nach dem Dafürhalten seiner Freundin, zur Verschwendungssucht neigte. Immer bestellte er sich teure Sachen, und die Trinkgelder, die er spendierte, waren auch zu hoch. „Natürlich: Steak mit Ei muss es sein!“ jammerte die Motz. Petersen murmelte, dass ein Mann sich doch anständig ernähren müsse. Die Motz aber, ganz außer Fassung, fragte plötzlich mit zornigem Sarkasmus die Mohrenwitz, ob Petersen ihr vielleicht eine Flasche Sekt angeboten habe. „Veuve Cliquot, extrafein!“ schrie die Motz und sprach, bei aller Gehässigkeit, den Namen der Sektmarke mit jener Delikatesse aus, welche sie als Salondame legitimierte. Hierüber war die Mohrenwitz nun ernsthaft beleidigt. „Ich muss doch sehr bitten!“ rief sie schrill. „Soll das ein Witz sein?!“ Das Monokel fiel ihr aus dem Auge, ihr pausbäckiges, vor Ärger rot gewordenes Gesicht sah plötzlich gar nicht mehr dämonisch aus. Kroge blickte schon verwundert auf; Frau von Herzfeld lächelte ironisch. Der schöne Bonetti aber klopfte der Motz auf die Schulter; gleichzeitig auch der Mohrenwitz, die kampfeslustig näher getreten war. „Zankt euch nicht, Kinder!“ riet er ihnen, um den Mund besonders müde und angewiderte Falten. „Dabei kommt doch nichts raus. Spielen wir lieber Karten.“
In diesem Augenblick wurden gedämpfte Rufe laut, und alles drehte sich der Türe zu, die sich geöffnet hatte. Dora Martin stand auf der Schwelle. Hinter ihr drängte sich, wie auf der Bühne das Gefolge hinter der Königin, das Ensemble, mit dem sie reiste.
Dora Martin lachte und winkte allen Mitgliedern des Hamburger Künstlertheaters zu; dabei rief sie mit ihrer heiteren Stimme, auf jene berühmte Alt, die von tausend jungen Schauspielerinnen im ganzen Lande kopiert wurde, in jedem Satz einige Worte zerdehnend: „Kinder, wir sind eingeladen, ein ganz langweiliges Bankett, furchtbar schade, aber wir müssen hingehen!“ Sie schien ihre eigene Sprechweise parodieren zu wollen, so eigenwillig verfuhr sie mit der Länge der Silben. Aber allen klang es lieblich in den Ohren, auch denen, welche die Martin nicht leiden konnten, zum Beispiel dem jungen Miklas. Es war nicht zu leugnen: Ihr Auftritt hatte großen Effekt gemacht.
Da geschah es, dass jemand hinter ihr sich durchs Gefolge drängte. Es war Hendrik Höfgen, der unvermittelt hervorkam. Er hatte den Smoking an, den er in mondänen Rollen auf der Bühne trug und der, aus der Nähe betrachtet, schon recht abgetragen und fleckig wirkte. Über den Schultern lag ihm ein weißes Seidentuch. Sein Atem flog; Wangen und Stirne waren hektisch gerötet. Einen recht beunruhigenden Eindruck machte das nervöse Lachen, das ihn schüttelte, während er sich in gehetzter Eile, umflattert vom Seidentuch, tief über die Hand der Diva bückte, und das nicht ohne eine gewisse irrsinnige Herzlichkeit schien. „Entschuldigen Sie“, brachte er hervor. „Es ist ja fantastisch: ich bin viel zu spät – was müssen Sie von mir denken – eine fantastische Sache…“ Das Lachen beutelte ihn, sein Gesicht wurde immer röter. „Aber ich wollte Sie doch nicht gehen lassen“, dabei richtete er sich endlich auf, „ohne Ihnen gesagt zu haben, wie sehr ich diesen Abend genossen habe – wie wunderschön es gewesen ist!“ Plötzlich schien die ungeheuer komische Angelegenheit, über die er fast zersprungen war vor Lachen, nicht mehr zu existieren; er zeigte nun ein ganz ernstes Gesicht.
Dafür war es jetzt an Dora Martin, ein wenig zu lachen, und das tat sie denn auch, besonders heiser und zauberhaft.
„Schwindler!“ rief sie, und von dem eigensinnig gedehnten „i“ kam sie gar nicht mehr weg. „Sie sind gar nicht im Theater gewesen! Sie haben sich ja versteckt!“ Dabei schlug sie ihn leicht mit dem gelben, schweinsledernen Handschuh. „Aber das macht nichts“, strahlte sie ihn an. „Sie sollen ja so begabt sein.“
Über diese Feststellung, die überraschend kam, erschrak Höfgen zunächst so stark, dass die helle Röte von seinem Gesicht wich, welches fahl wurde. Dann aber sagte er, mit einer Stimme, die schmelzend klang: „Ich? Begabt? Das ist doch ein ganz unbewiesenes Gerücht…“
Die Vokale konnte auch er zerdehnen, nicht nur Dora Martin brachte dies fertig. Seine Sprachkoketterie hatte eigenen Stil, er war keineswegs darauf angewiesen, irgend jemanden zu kopieren. Dora Martin girrte; er aber sang vor Manieriertheit. Dabei zeigte er jenes Lächeln, das er auf den Proben den Damen vorzumachen pflegte, wenn sie verfängliche Szenen zu spielen hatten: Es entblößte die Zähne und war ziemlich gemein. Er bezeichnete es als das „aasige“ Lächeln. („Aasiger – verstehst du, meine Liebe? —, aasiger!“ mahnte er auf den Proben Rahel Mohrenwitz oder Angelika Siebert, und er machte es vor.)
Ihre Zähne zeigte auch Dora Martin; er während der Mund „babytalk“ sprach und der Kopf kokett zwischen den hochgezogenen Schultern steckte, forschten ihre großen, klugen, unbetrügbaren und traurigen Augen in Höfgens Gesicht. „Sie werden es schon noch beweisen, Ihr Talent!“ sagte sie leise, und eine Sekunde lang war nicht nur ihr Blick ernst, sondern auch ihr Gesicht. Ernsten Gesichtes, beinah drohend, nickte sie ihm zu. Höfgen, der sich noch vor einer Viertelstunde hinterm Paravent versteckt hatte, hielt ihren Blick aus. Dann lachte die Martin wieder; girrte: „Wir sind viel zu spät!“; winkte und entschwand mit Gefolge. Höfgen war in die Kantine getreten.
Die Begegnung mit Dora Martin hatte ihn auf wunderbare Art aufgeheitert; er schien jetzt in einer geradezu festlichen Laune zu sein. Von seinem Antlitz kam ein gnädiger Glanz. Alle schauten auf ihn, nun beinah ebenso bezwungen, wie sie vorhin auf die Berliner Diva geschaut hatten. – Ehe Höfgen Direktor Kroge und Frau von Herzfeld begrüßte, war er zu Garderobier Bock getreten. „Hör mal, mein Böckchen“, sang er und stand verführerisch da: Hände in die Hosentaschen vergraben, Schultern hochgezogen, und auf den Lippen das aasige Lächeln. „Du musst mir mindestens sieben Mark fünfzig leihen. Ich will anständig zu Abend essen, und ich habe so ein Gefühl: Väterchen Hansemann verlangt heute Barbezahlung.“ Aus den schillernden Edelsteinaugen warf er einen misstrauisch schiefen Blick auf Hansemann, der mit blauroter Nase unbewegt hinter der Theke saß. Bock war aufgesprungen; aus Schreck über Höfgens einerseits ehrenvolles, andererseits grausiges Ansinnen waren seine Augen noch wässriger, seine Wangen dunkelrot geworden. Während er stumm erregt in den Taschen wühlte und Hans Miklas mit gehässig gespanntem Blick den ganzen Vorfall beobachtete, war die kleine Angelika eilig hinzugetreten. „Aber Hendrik!“ sagte sie schnell und schüchtern. „Wenn du Geld brauchst – ich kann dir doch fünfzig Mark bis zum Ersten leihen!“ Sofort bekam Höfgen fischig kalte Augen. Er sagte hochmütig über die Schulter: „Mische dich nicht in unsere Männergeschäfte, meine Kleine. Bock gibt gerne.“ Der Garderobier nickte aufgeregt, während sich die Siebert mit nassen Augen zurückzog. Höfgen ließ, ohne sich zu bedanken, Bocks Silbermünzen nachlässig in seine Tasche gleiten. Miklas, Knurr und die Efeu schauten finster, Bock fassungslos und Angelika weinend hinter ihm drein, während er wiegenden Ganges, immer noch das weiße Seidentuch über den Schultern, das Lokal durchschritt. „Väterchen Schmilz lässt mich nämlich verhungern“, erklärte er, das sieghaft lächelnde Gesicht dem Direktorentisch zugewandt.
Dort wurde er mit einigem Hallo empfangen; sogar Kroge zwang sich zu einer etwas lärmenden und nicht ganz echten Herzlichkeit. „Na, alter Sünder, wie geht’s? Haben Sie den Abend gut überstanden?“ Er bekam scharfe Falten um den Katermund, fast wie die Motz, und falsche Augen hinter den Brillengläsern; plötzlich war ihm anzumerken, dass er nicht nur kulturpolitische Essays und hymnische Lyrik schrieb, sondern seit über dreißig Jahren mit dem Theater zu tun hatte. – Höfgen und Otto Ulrichs schüttelten sich vertraut, stumm und ausführlich die Hände. Direktor Schmilz sagte etwas belanglos Scherzhaftes, mit seiner überraschend weichen, angenehmen Stimme; Frau von Herzfeld aber lächelte grundlos ironisch, wobei ihre goldbraunen Augen, feucht vor Innigkeit und fast flehend, auf Hendrik gerichtet waren. Er ließ sich von ihr bei der Auswahl seines Abendessens beraten, was ihr Anlass gab, an ihn heranzurücken und ihren schweratmenden Busen in seine Nähe zu bringen. Sein aasiges Lächeln schien sie nicht abzuschrecken: Sie war es gewohnt, und es gefiel ihr.
Als Väterchen Hansemann die Bestellung entgegengenommen hatte, fing Höfgen an, von seiner „Frühlings Erwachen“[28 - „Frühlings Erwachen“: ein Drama von Frank Wedekind.] – Inszenierung zu sprechen. „Es wird anständig werden, glaube ich“, sagte er ernst; dabei glitten seine prüfenden Augen durch das Lokal, über die Schauspieler hin, wie die Augen eines Feldherrn über Truppen. „An der Wendla kann die Siebert nichts verderben; Bonetti ist kein idealer Melchior Gabor, aber er schafft es; unsere dämonische Mohrenwitz legt eine erstklassige Ilse hin.“ – Es geschah nicht sehr häufig, dass er ohne Mätzchen redete, sondern ernsthaft und um der Sache willen wie eben jetzt. Kroge lauschte ihm achtungsvoll, nicht ohne Überraschung. Es war die Herzfeld, welche die Stimmung wieder verdarb, indem sie sarkastisch-schmeichlerisch, ihr großes, flaumiggepudertes Gesicht ziemlich nahe bei Höfgen, bemerkte: „Nun, und was den Moritz Stiefel betrifft – da wurde ja gerade von berufenster Seite, von Dora selber, festgestellt, dass der junge Schauspieler, dem wir diese Rolle anvertraut haben, nicht ganz unbegabt ist…“ Kroge runzelte missbilligend die Stirne; Höfgen seinerseits schien die Neckerei zu überhören. „Und wie werden Sie eigentlich als Frau Gabor, meine Teure?“ fragte er die Herzfeld ins Gesicht. Dies war offener und derber Hohn. Dass Frau Hedda eine unbegabte Schauspielerin war, gehörte zu den bekannten Tatsachen; auch wusste jeder, dass sie darunter litt. Man spottete gern darüber, dass die kluge Dame es nicht lassen konnte, aufzutreten, und sei es auch nur in bescheidenen Mütterrollen. Auf Hendriks Ungezogenheit hin versuchte sie, gleichgültig die Achseln zu zucken; dabei aber zog eine ins Violette spielende Röte über die große Fläche ihres unjungen Gesichts. Kroge sah es, und sein Herz zog sich zusammen in einem Mitleid, das nicht weit von Zärtlichkeit war. Kroge hatte vor vielen Jahren ein Verhältnis mit Frau von Herzfeld gehabt.
Um das Thema zu wechseln oder um auf das einzige Thema zu kommen, das ihn wirklich beschäftigte, begann Ulrichs ohne Übergang vom Revolutionären Theater zu sprechen.
Das Revolutionäre Theater war geplant als eine Serie von Sonntag-Vormittag-Veranstaltungen, die unter der Leitung Hendrik Höfgens und dem Protektorat einer kommunistischen Organisation stehen sollten. Ulrichs, für den die Bühne zunächst und vor allem ein politisches Instrument bedeutete, hing mit zäher Leidenschaft an diesem Projekt. Das Stück, das man für die Eröffnungsvorstellung ausgesucht habe, eigne sich glänzend, sagte er nun, er habe es noch einmal genau durchgearbeitet. „Man interessiert sich in der Partei sehr ernsthaft für unsere Sache“, erklärte er und schaute mit einem bedeutungsvollen Verschwörerblick auf Höfgen, an Kroge, Schmilz und der Herzfeld vorbei, aber doch stolz darauf, dass sie es hörten und dass es sie beeindrucken würde. – „Nun, die Partei wird mir keinen Schadenersatz zahlen, wenn die guten Hamburger mir dann mein Haus boykottieren“, brummte Kroge, den der Gedanke an das Revolutionäre Theater immer skeptisch und verdrießlich stimmte. „Ja“, sagte er noch, „1918 – da konnte man sich solche Experimente leisten. Aber heute…“ Höfgen und Ulrichs tauschten einen Blick, der ein hochmütiges und geheimes Einverständnis enthielt und viel Geringschätzung für die kleinbürgerlichen Bedenken ihres Direktors. Der Blick dauerte ziemlich lange, Frau von Herzfeld bemerkte ihn und litt. Schließlich wendete sich Höfgen, etwas väterlich herablassend, an Kroge und Schmilz. „Das Revolutionäre Theater wird uns nicht schaden – sicher nicht – glauben Sie es nur, Väterchen Schmilz! Was wirklich gut ist, kompromittiert einen niemals. Das Revolutionäre Theater wird gut, es wird glänzend! Eine Leistung, hinter der ein echter Glaube, ein wirklicher Enthusiasmus steht, überzeugt alle – auch die Feinde werden verstummen vor dieser Manifestation unserer glühenden Gesinnung.“ Seine Augen schillerten, schielten ein wenig und schienen verzückt in Fernen zu schauen, wo die großen Entscheidungen fallen. Das Kinn hielt er stolz gereckt; auf dem fahlen, nach hinten geneigten, empfindlichen Antlitz lag ein siegesgewisser Glanz. ,Das ist wirkliche Ergriffenheit’, dachte Hedda von Herzfeld. ,Das kann er nicht spielen – so begabt er auch ist.’ Triumphierend sah sie Kroge an, der eine gewisse Bewegtheit nicht verbergen konnte. Ulrichs machte eine feierliche Miene.
Während alle noch gebannt saßen von den Effekten seines rührenden Enthusiasmus, änderte Höfgen plötzlich Haltung und Ausdruck. Er begann überraschend zu lachen und deutete auf die Fotografie eines „Heldenvaters“, die über dem Tisch an der Wand hing: die Arme drohend verschränkt, biederer Blick unter finsterer Braue, breiter Vollbart, sorgfältig ausgebreitet auf einem phantastischen Jägerwams. Hendrik konnte sich gar nicht darüber beruhigen, wie drollig er den alten Burschen fand. Unter vielem Gelächter, nachdem Hedda ihm den Rücken geklopft hatte, weil er am Salat zu ersticken drohte, brachte er hervor, dass er selber ganz ähnlich, ja, fast genauso ausgesehen habe – als er nämlich noch die Väterrollen gespielt hatte, an der Norddeutschen Wanderbühne.
„Als ich noch ein Knabe war“, jubelte Hendrik, „da sah ich doch so phantastisch alt aus. Und auf der Bühne ging ich immer gebückt vor lauter Verlegenheit. In den ,Räubern’[29 - „Die Räuber“: ein Drama von Friedrich Schiller.] ließ man mich den alten Moor spielen. Ich war ein hervorragend guter alter Moor. Jeder von meinen Söhnen war zwanzig Jahre älter als ich.“
Da er so laut lachte und von der Norddeutschen Wanderbühne sprach, eilten von allen Tischen die Kollegen herbei: Man wusste, dass nun Anekdoten kommen würden, und zwar keine abgestandenen alten, sondern neue, und wahrscheinlich ziemlich gute – es geschah selten, dass Hendrik sich wiederholte.
Es wurde ein reizender Abend. Höfgen war blendend in Form. Er bezauberte, er brillierte. Als hätte er ein großes Publikum vor sich, anstatt nur die paar geringen Kollegen, verschwendete er, großmütig-übermütig, Witz, Charme und Anekdotenschatz. Was war nicht alles an dieser Wanderbühne passiert, wo er die Väterrollen hatte spielen müssen! Die Motz bekam schon Atemnöte vor Lachen. „Kinder, ich kann nicht mehr!“ schrie sie, und da Bonetti ihr drollig-galant mit dem Tüchlein fächelte, übersah sie, dass Petersen sich schon wieder Schnaps bestellte. Als Höfgen aber dazu überging, mit schriller Stimme, flatternden Gesten und unheimlich schielenden Augen die jugendliche Sentimentale der Wanderbühne nachzuahmen, da verzog sogar Vater Hansemann die starre Miene, und Herr Knurr musste sein Grinsen hinter dem Taschentuch verbergen. Mehr Triumph war nicht herauszuholen aus der Situation. Höfgen brach ab. Auch die Motz wurde ernst, da sie feststellte, wie besoffen Petersen war. Kroge gab das Zeichen zum Aufbruch. Es war zwei Uhr morgens. Zum Abschied schenkte die Mohrenwitz, die immer originelle Einfälle hatte, Hendrik ihre lange Zigarettenspitze, ein dekoratives, übrigens wertloses Stück. „Weil du heute abend so enorm amüsant gewesen bist, Hendrik.“ Ihr Monokel blitzte sein Monokel an. Man sah, dass Angelika Siebert, die neben Bonetti stand, vor Eifersucht eine weiße Nase bekam, und dazu Augen, die tränenvoll und gleichzeitig ein wenig tückisch waren.
Frau von Herzfeld hatte Hendrik aufgefordert, noch eine Tasse Kaffee mit ihr zu trinken. Im leeren Lokal machte Vater Hansemann schon die Lampen aus. Für Hedda war das Halbdunkel vorteilhaft: Ihr großes, weiches Gesicht mit den sanften, klug beseelten Augen erschien nun jünger, oder doch alterslos. Dieses war nicht mehr das betrübte Antlitz der alternden, intellektuellen Frau. Die Wangen wirkten nicht mehr flaumig, sondern glatt. Das Lächeln um die orientalisch trägen, halbgeöffneten Lippen war nicht mehr ironisch, sondern fast verführerisch. Still und zärtlich schaute Frau von Herzfeld auf Hendrik Höfgen. Sie dachte nicht daran, dass sie selber reizvoller aussah als sonst; nur dass Hendriks Gesicht mit dem angestrengten Leidenszug an den Schläfen und dem edlen Kinn blass und deutlich in der Dämmerung stand, merkte sie und genoss sie.
Hendrik hatte seine Ellenbogen auf den Tisch gestützt und die Fingerspitzen seiner ausgestreckten Hände gegeneinander gelegt. Diese anspruchsvolle Haltung leistete er sich wie einer, der besonders schöne, gotisch spitze Hände hat. Höfgens Hände waren aber keineswegs gotisch; vielmehr schienen sie den Leidenszug der Schläfen durch ihre unschöne Derbheit widerlegen zu wollen. Die Handrücken waren sehr breit und rötlich behaart; breit waren auch die ziemlich langen Finger, die in eckigen, nicht ganz sauberen Nägeln endeten. Gerade diese Nägel waren es wohl, die den Händen ihren unedlen, beinah unappetitlichen Charakter gaben. Sie schienen aus minderwertiger Substanz zu sein: bröckelig, spröde, ohne Glanz, ohne Form und Wölbung.
Diese Schadhaftigkeiten und Mängel aber verbarg die vorteilhafte Dämmerung. Hingegen ließ sie das träumerische Schielen der grünlichen Augen rätselhaft und reizend wirken.
„Woran denken Sie, Hendrik?“ fragte die Herzfeld, nach langem Schweigen, mit einer innig gedämpften Stimme.
Ebenso leise antwortete Höfgen: „Ich denke daran – dass Dora Martin unrecht hat…“ Hedda ließ ihn, über seine aneinandergelegten Hände hinweg, ins Dunkel reden, ohne zu fragen oder zu widersprechen. „Ich werde mich nicht beweisen“, klagte er in die Dämmerung. „Ich habe nichts zu beweisen. Niemals werde ich erstklassig sein. Ich bin provinziell.“ Er verstummte, presste die Lippen aufeinander, als erschräke er selber vor den Erkenntnissen und Bekenntnissen, zu denen die sonderbare Stunde ihn brachte.
„Und weiter?“ fragte Frau von Herzfeld mit sanftem Vorwurf. „Und weiter denken Sie nichts? Immer nur daran?“ Da er stumm blieb, dachte sie: ,Ja – dieses ist wohl das einzige, was ihn wirklich beschäftigt. Das mit dem politischen Theater vorhin und sein Enthusiasmus für die Revolution – das war also auch nur Komödie.’ Diese Entdeckung erfüllte sie mit Enttäuschung; irgendwo fühlte sie sich aber auch auf eine merkwürdige Art von ihr befriedigt. Er ließ mysteriös die Augen schillern; eine Antwort hatte er nicht.
„Merken Sie denn nicht, wie Sie die kleine Angelika quälen?“ fragte die Frau neben ihm. „Spüren Sie denn nicht, dass Sie – andere leiden machen? Irgendwo müssen Sie doch für all das bezahlen.“ Sie ließ den klagenden und suchenden Blick nicht von ihm. „Irgendwo müssen Sie doch büßen – und lieben.“
Nun war es ihr doch peinlich, dass sie dies gesagt hatte. Es war entschieden zuviel, sie hatte sich gehen lassen. Schnell entfernte sie ihr Gesicht von seinem. Zu ihrem Erstaunen bestrafte er sie durch kein böses Grinsen, durch kein höhnisches Wort. Vielmehr blieb sein Blick schielend, schillernd und starr, ins Dunkel gerichtet, als suchte er dort Antwort auf dringliche Fragen, Stillung seiner Zweifel und das Bild einer Zukunft, deren eigentlicher Sinn es war, ihn groß zu machen.
II
Die Tanzstunde
Für den nächsten Tag hatte Hendrik den Beginn der Probe auf halb zehn Uhr angesetzt. Pünktlich versammelte sich das Ensemble, soweit es in „Frühlings Erwachen“ beschäftigt war, teils auf der zugigen Bühne, teils im spärlich beleuchteten Parkett. Nachdem man etwa eine Viertelstunde lang gewartet hatte, entschloss sich Frau von Herzfeld dazu, Höfgen aus dem Büro zu holen, wo er sich seit neun Uhr mit den Direktoren Schmilz und Kroge besprach.
Gleich bei seinem Eintritt waren sich alle darüber klar, dass er sich heute in der ungnädigsten Stimmung befand – der strahlende Causeur vom vorigen Abend war nicht wiederzuerkennen. Die Schultern auf nervöse Art hochgezogen, die Hände in den Hosentaschen vergraben, ging er eilig durch das Parkett und bat, mit einer vor Gereiztheit fast tonlosen Stimme, um ein Exemplar des Textbuches. „Ich habe meines zu Hause liegenlassen.“ Er hatte einen bitter gekränkten Ton, der gleichsam allen Anwesenden einen leisen, aber intensiven Vorwurf aus dem Umstand machte, dass er, Hendrik, beim Weggehen vergesslich und zerstreut gewesen war. „Nun, darf ich bitten?“ Es gelang ihm, zugleich wegwerfend gedämpft und sehr schneidend zu sprechen. „Hat denn niemand so ein Heftchen für mich?“
Die kleine Angelika reichte ihm das ihre. „Ich brauche mein Buch nicht mehr“, sagte sie errötend. „Ich kann meinen Text.“
Hendrik, anstatt sich zu bedanken, bemerkte kurz: „Das will ich auch hoffen!“ – und wandte sich von ihr ab.
Über dem roten Seidenschal, den er statt eines Hemdes trug – oder der doch das Hemd, falls er ein solches anhatte, versteckte —, wirkte sein Gesicht besonders fahl. Das eine Auge schaute, unter halb gesenktem Lid, verächtlich und böse; vor dem anderen blitzte das Monokel. Als er mit einer plötzlich ganz hellen, durchdringenden und etwas klirrenden Kommandostimme rief: „Anfangen, Herrschaften!“ – zuckte alles zusammen.
Er rannte im Zuschauerraum umher, während auf der Bühne gearbeitet wurde. Den Moritz Stiefel – die Rolle, welche er sich selber vorbehalten hatte – ließ er von Miklas, dem seine eigene Partie nur sehr wenig zu tun gab, markieren. Darin konnte man eine besondere Bosheit sehen, da der arme Miklas doch seinerseits den Moritz, für sein Leben gerne gespielt hätte. Übrigens schien Höfgen, mit provokantem Hochmut, den Kollegen andeuten zu wollen, dass er seinerseits es keineswegs nötig habe, irgend etwas zu probieren oder vorzubereiten: er war der Regisseur, stand über dem Ganzen; seine Routine war so groß wie sein Genie, die eigene Rolle erledigte er nebenbei; erst auf der Generalprobe würde man es von ihm zu sehen und zu hören bekommen, wie Moritz Stiefel, der düstere Gymnasiast, der verzweifelt liebende, der Selbstmörder aufzufassen und zu spielen sei.
Hingegen bekam man es jetzt schon von ihm gezeigt, was man aus dem Mädchen Wendla, dem Knaben Melchior, der mütterlichen Frau Gabor machen konnte. Hendrik sprang, mit einer überraschenden Behendigkeit, auf die Bühne, und wirklich: er verwandelte sich in das zarte Mädchen, das in den morgendlichen Garten tritt und die ganze Welt umarmen möchte, da sie an den Geliebten denkt; in den lebenshungrigen und stolzen Knaben; in die kluge, sorgenvolle Mutter. Seine Stimme konnte zärtlich, übermütig oder gedankenvoll klingen. Es gelang ihm, in diesem Augenblick kindlich jung auszusehen, im nächsten aber uralt. Er war ein glänzender Schauspieler.
Wenn er es dem schönen Bonetti, der die Brauen halb verärgert, halb achtungsvoll hochzog, oder der demütigen Angelika, die gegen Tränen kämpfte, eindrucksvoll demonstriert hatte, was man mit ihren Rollen eigentlich anfangen könnte, wenn man nur das Zeug dazu hätte, schnitt er eine müde und verächtliche Grimasse, klemmte sich das Monokel vors Auge und stieg ins Parkett zurück. Von dort aus erklärte, arrangierte und kritisierte er weiter. Keiner blieb verschont von seinen höhnisch herabsetzenden Worten, sogar Frau von Herzfeld wurde abgekanzelt – was sie mit einem verzerrt-ironischen Lächeln hinnahm —; die kleine Angelika hatte sich schon mehrmals tränenüberströmt in die Kulisse zurückgezogen; auf Bonettis Stirne zeigten sich Zornesadern; am tiefsten und leidenschaftlichsten aber ärgerte sich Hans Miklas, dessen Gesicht vor Zorn zu verfallen und schwarze Löcher zu bekommen schien.
Da alle litten, wurde Hendrik zusehends besserer Laune. Während der Mittagspause, in der Kantine, unterhielt er sich recht angeregt mit Frau von Herzfeld. Um halb drei Uhr ließ er die Gesellschaft wieder zur Arbeit antreten. Es war gegen halb vier Uhr, als der schöne Bonetti seinen angewiderten Zug um den Mund bekam, die Hände in die Hosentaschen steckte und gnauzend wie ein verwöhntes Kind sagte: „Ist denn noch nicht bald Schluss mit der Schinderei?“ Daraufhin warf Höfgen ihm einen vernichtenden Blick zu aus seinen weichen und eiskalten Augen. Er sagte: „Wann aufgehört wird, das bestimme allein ich!“ und hielt das schöne Kinn besonders hoch gereckt. Dem eingeschüchterten Ensemble zeigte er das Antlitz eines edlen und nervösen Tyrannen. „Weitermachen, Herrschaften!“ rief er, wobei seine Stimme den hellen Metallton hatte, dem fast niemand widerstehen konnte. „Wo haben wir unterbrochen?“
Man probierte folgsam die nächste Szene, war aber kaum mit ihr zu Ende gekommen, als Hendrik seinerseits einen Blick auf die Armbanduhr warf. Sie zeigte ein Viertel vor vier Uhr: Während er es feststellte, erschrak er, und zwar so heftig, dass es weh im Magen tat. Ihm war eingefallen, dass er um vier Uhr eine Verabredung mit Juliette in seiner Wohnung hatte. Sein Lächeln war etwas krampfhaft, als er dem Ensemble mit hastigfreundlichen Worten mitteilte, nun müsse Schluss gemacht werden. Dem jungen Miklas, der sich ihm mürrischen Gesichtes nahte, um irgendeine Frage zu stellen, winkte er eilig ab. Er rannte durch das dunkle Parkett dem Ausgang zu; legte das steile Stück Weges, das zwischen dem Theaterportal und der Kantine lag, laufend zurück; langte atemlos im H. K. an; riss dort seinen braunen Ledermantel und den weichen grauen Hut vom Nagel und war schon davon.
Die altmodische Villa, in deren Erdgeschoß er ein Zimmer bewohnte, lag in einer jener stillen Straßen, die vor dreißig Jahren zu den vornehmsten der Stadt gehört hatten. Mit der Inflation waren die meisten Bewohner der feinen Gegend arm geworden; ihre Villen mit den vielen Zinnen und Giebeln sahen schon recht heruntergekommen aus – verwahrlost, wie die großen Gärten, die sie umgaben. Auch Frau Konsul Mönkeberg, der Hendrik monatlich vierzig Mark für eine geräumige Stube bezahlte, fand sich in bedrängten Verhältnissen. Trotzdem war sie eine tadellose, stolze alte Dame geblieben, die ihre sonderbaren Kostüme mit Puffärmeln und Spitzenumhang würdevoll trug, auf deren glattem Scheitel niemals ein Haar sich widerspenstig zu zeigen wagte und um deren schmale Lippen ironische, aber nicht bittere Fältchen spielten.
Hendrik fühlte sich unsicher in der Gegenwart der Dame Mönkeberg; ihre vornehme Herkunft und Vergangenheit schüchterten ihn ein. So war es ihm auch jetzt durchaus nicht angenehm, der feinen Alten im Vestibül zu begegnen, nachdem er gerade die Haustür so krachend hinter sich ins Schloss geworfen hatte. Angesichts ihrer imposanten Haltung nahm auch er sich ein wenig zusammen; zupfte sich den roten Seidenschal zurecht und klemmte sich das Monokel vors Auge. „Guten Abend, gnädige Frau, wie geht es Ihnen?“ sprach er mit der singenden Stimme, die sich am Ende der Höflichkeitsfloskel nicht hob, wodurch der formelhaft konventionelle und anmutig leere Charakter des Satzes betont ward. Die artige kleine Anrede begleitete er mit einer leichten Verneigung, die, bei aller eleganten Nachlässigkeit, doch beinah höfischen Stil hatte.
Die Witwe Mönkeberg lächelte nicht; nur die Fältchen einer erfahrenen Ironie spielten ihr ein wenig stärker um Augen und schmale Lippen, als sie erwiderte: „Beeilen Sie sich, lieber Herr Höfgen! Ihre – Lehrerin erwartet Sie schon seit einer Viertelstunde.“ Die boshafte kleine Pause, welche Frau Mönkeberg vor dem Wort „Lehrerin“ machte, bewirkte, dass Hendrik sein Gesicht heiß werden fühlte. ,Sicher bin ich ganz rot geworden’, dachte er, ärgerlich und beschämt. ,Aber sie kann es wohl hier im Halbdunkel nicht bemerken’, versuchte er, sich selbst zu beruhigen, während er sich mit der vollendeten Anmut eines spanischen Granden zurückzog.
„Ich danke Ihnen, gnädige Frau.“ Er hatte die Türe zu seinem Zimmer geöffnet.
Im Räume herrschte ein rosiges Halbdunkel; es brannte nur die mit buntem Seidentuch verhüllte Lampe auf dem niedrigen, runden Tisch neben dem Schlafsofa. In die farbige Dämmerung hinein rief Hendrik Höfgen mit einer ganz kleinen, demütigen, etwas zitternden Stimme: „Prinzessin Tebab, wo bist du?“
Aus einer dunklen Ecke antwortete ihm ein tiefes, grollendes Organ: „Hier, du Schwein – wo denn sonst?“
„Oh – danke —-“, sagte, immer noch sehr leise, Hendrik, der mit gesenktem Haupt bei der Türe stehengeblieben war. „Ja … jetzt kann ich dich sehen … Ich bin froh, dass ich dich sehen kann…“
„Wieviel Uhr ist es?“ schrie die Frau aus der Ecke. Hendrik versetzte bebend: „Ungefähr vier Uhr – denke ich.“
„Ungefähr vier Uhr! Ungefähr vier Uhr!“ höhnte die böse Person, die immer noch im Schatten unsichtbar blieb. „Ist ja drollig! Ist ja ausgezeichnet!“ Sie sprach mit einem stark norddeutschen Akzent. Ihre Stimme war ausgeschrien wie die eines Matrosen, der sehr viel säuft, raucht und schimpft. „Es ist ein Viertel nach vier Uhr“, stellte sie fest, plötzlich unheimlich leise.
Mit derselben schauerlichen Gedämpftheit, die nichts Gutes verhieß, forderte sie ihn auf: „Willst du nicht eben mal ein bisschen näher an mich ran kommen, Heinz – nur ein ganz klein bisschen! Aber erst mach das Licht an!“ Unter der Anrede „Heinz“ zuckte Hendrik zusammen wie unter dem ersten Schlag. Er gestattete es keinem Menschen, auch seiner Mutter nicht, ihn so zu nennen: Nur Juliette durfte es wagen. Außer ihr wusste es wohl niemand hier in der Stadt, dass sein eigentlicher Vorname Heinz war – ach, in welcher süßen und schwachen Stunde hatte er es ihr anvertraut? Heinz: das war der Name, mit dem alle ihn angeredet hatten, bis zu seinem achtzehnten Jahr. Erst als er sich darüber klargeworden war, dass er Schauspieler und berühmt werden wollte, hatte er sich den gewählteren „Hendrik“ zugelegt. Wie schwer war es bei der Familie durchzusetzen gewesen, dass man sich an ihn gewöhnte und ihn ernst nahm – diesen ausgefallenen, anspruchsvollen „Hendrik“! Wie viele Briefe, die mit „Mein lieber Heinz!“ begannen, hatte man unbeantwortet gelassen – bis auch die Mutter Bella und die Schwester Josy sich endlich zu der neuen Anrede bequemten. Mit Jugendfreunden, die hartnäckig bei „Heinz“ blieben, hatte man den Verkehr rigoros abgebrochen; übrigens legte man ohnedies keinen Wert auf den Umgang mit Kameraden, die peinliche Anekdoten aus einer schalen Vergangenheit mit dem wiehernden Gelächter eines taktlosen Humors hervorzuholen liebten. Heinz war gestorben; Hendrik sollte groß werden. – Der junge Schauspieler Höfgen kämpfte einen erbitterten Kampf mit den Agenturen, den Theaterdirektoren und Feuilletonredaktionen darum, dass man seinen frei erfundenen, preziösen Vornamen richtig schriebe. Er zitterte vor Zorn und Gekränktheit, wenn er sich auf einem Programm oder in einer Rezension als „Henrik“ aufgeführt fand. Das kleine „d“ in der Mitte seines selbstgewählten Namens war für ihn ein Buchstabe von ganz besonderer, magischer Bedeutung: Wenn er es erst erreicht haben würde, dass ausnahmslos alle Welt ihn als „Hendrik“ anerkannte – dann war er am Ziel, ein gemachter Mann.
Eine so dominierende Rolle spielte der Name – der mehr als eine Personalbezeichnung, nämlich eine Aufgabe und Verpflichtung war – in Hendrik Höfgens ehrgeizigen Gedanken. Trotzdem duldete er es nun, dass Juliette aus ihrer finsteren Ecke ihn drohend anredete mit dem abgelegten und verhassten „Heinz“.
Er gehorchte ihren beiden Befehlen; bewegte den Lichtschalter, so dass plötzlich eine grelle Helligkeit ihm die Augen blendete, und machte dann, die Stirn noch immer gesenkt, ein paar Schritte auf Juliette zu. Einen Meter entfernt von ihr blieb er stehen; auch dieses aber war ihm nicht gestattet. Sie murmelte mit einer heiseren und höchst beunruhigenden Freundlichkeit – wobei ihre Zähne zusammengebissen blieben: „Komm doch näher, mein Junge!“
Da er sich nicht von der Stelle bewegte, lockte sie ihn, wie einen Hund, den man mit Schmeicheltönen an sich heranholt, um dann um so grausamer zu strafen: „Nur näher, mein Schöner! Ganz nahe! Nur keine Angst!“ Er blieb immer, noch bewegungslos, immer noch mit dem geneigten Gesicht; Schultern und Arme hingen ihm schlaff nach vorne, um Schläfen und Augenbrauen trat ein leidender, gespannter Zug hervor; die geblähten Nüstern schnupperten ein penetrant süßes und gemeines Parfüm, das sich mit einem anderen, noch wilderen, aber durchaus nicht süßen Geruch – der Ausdünstung eines Körpers – auf erregende und peinigende Art vermischte.
Da das Mädchen durch seine wehleidige und edle Positur auf die Dauer gelangweilt und irritiert wurde, ließ sie plötzlich eine Zornesstimme hören, die wie heiseres Brüllen aus dem Urwald klang: „Steh doch nicht da, als ob du dir in die Hosen gemacht hättest! Kopf hoch, Mensch!“ Majestätischer fügte sie hinzu: „Blicke mir ins Gesicht!“
Er hob langsam den Kopf, während sich der Leidenszug um seine Schläfen vertiefte. Im fahlen Antlitz waren seine grünblauen Augen erweitert – vor Wonne oder vor Angst. Sprachlos starrte er auf Prinzessin Tebab, seine Schwarze Venus.
Negerin war sie nur von der Mutter her – ihr Vater war ein Hamburger Ingenieur gewesen —; aber die dunkle Rasse hatte sich als stärker erwiesen als die helle; sie sah nicht nach „Halbblut“ aus, sondern beinah nach Vollblut. Die Farbe ihrer rauhen, stellenweis etwas rissigen Haut war dunkelbraun, an manchen Partien – zum Beispiel auf der niedrigen, gewölbten Stirne und auf den schmalen, sehnigen Handrücken – fast schwarz. Heller gefärbt hatte die Natur nur das Innere ihrer Hände; während sie selbst, mittels Auflegen von Schminke, die Farbe ihrer oberen Wangenhälften eigenwillig verändert hatte: über den starken, brutal geformten Backenknochen lag das künstliche Hellrot wie ein hektischer Schimmer. Auch die Augenpartie war kosmetisch bearbeitet: die Brauen abrasiert und durch schmale Kohlestriche ersetzt; die Wimpern künstlich verlängert; die Schatten auf dem oberen Lid, und bis hinauf zu den schmalen Brauen, ins Rötlichblaue vertieft. Hingegen hatte sie den wulstigen Lippen die natürliche Farbe gelassen. Über den blendenden Zahnreihen, die sie beim Lachen wie beim Schimpfen entblößte, erschienen sie rauh, wie das Fleisch der Hände und des Halses, und von einem dunklen Violett, gegen dessen trüben Ton das gesunde Rot des Zahnfleisches und der Zunge heftig kontrastierte. In ihrem Gesicht, das von den beweglichen, grausamen und gescheiten Augen und von den blitzenden Zähnen beherrscht war, bemerkte man zunächst gar nicht die Nase; wie flach und eingedrückt sie war, erkannte man erst bei genauerem Hinschauen. Diese Nase schien in der Tat so gut wie nicht vorhanden; sie wirkte nicht wie eine Erhöhung inmitten der wüsten und auf eine schlimme Art attraktiven Maske; eher wie eine Vertiefung.
Für Juliettens höchst barbarisches Haupt hätte man sich als Hintergrund eine Urwaldlandschaft gewünscht statt dieser bürgerlichen Stube mit ihren Plüschmöbeln, Nippesfiguren und seidenen Lampenschirmen. Übrigens enttäuschte nicht nur die Dekoration, von der dieses Haupt sich abhob, sondern auch die Krönung des Hauptes selber: das Haar. Es war keineswegs die krause, schwarze Mähne, die man zu dieser Stirne, diesen Lippen passend gefunden hätte; vielmehr überraschte es durch Glattheit und eine mattblonde Färbung. Die Frisur war einfach; der Scheitel in der Mitte gezogen. Die dunkle Dame gefiel sich in der Behauptung, so seien ihre Haare immer gewesen, niemals habe sie etwas an ihnen verändert: ihre Farbe und Beschaffenheit habe sie vom Vater, dem Ingenieur Martens aus Hamburg, geerbt.
Dass ein Mann dieses Namens und dieses Berufes ihr Vater gewesen war, schien festzustehen oder wurde doch von niemandem bestritten. Übrigens war Martens seit Jahren tot. Der arbeitsreiche Aufenthalt im Inneren Afrikas war ihm nicht bekommen. Geschwächt vom Malariafieber, das Herz ruiniert von Chininspritzen und von alkoholischen Exzessen, war er nach Hamburg zurückgekehrt, um dort, eilig und ohne viel Aufsehen zu erregen, zu sterben. Das Negermädchen, das seine Geliebte gewesen war, ließ er am Kongo; ebenso das dunkelhäutige kleine Geschöpf, dessen Vater er sein mochte. Die Nachricht vom Tode des Ingenieurs drang nicht bis nach Afrika. Nach geraumer Zeit verlor Juliette auch noch die Mutter; nun machte sie sich auf in das sehr ferne, sicherlich sehr wundervolle Deutschland. Sie hoffte, dort von der väterlichen Liebe lanciert zu werden. Indessen konnte man ihr nicht einmal das Grab des Ingenieurs zeigen; die Gebeine ihres armen Vaters waren verlorengegangen wie sein Andenken.
Ein Glück für die junge Juliette, dass sie leidlich Steptanzen konnte: sie hatte es noch bei den Ihren gelernt. So gelang es ihr, bald eine Anstellung in einem der besten Etablissements von St. Pauli zu finden. Dort hätte sie sich sicherlich halten können, und vielleicht wäre der gescheiten und energischen Person ein ehrenvoller Aufstieg beschieden gewesen – hätten nur ihr heftiges Temperament und eine unbeherrschbare Neigung für starke Getränke ihr nicht den allerfatalsten Strich durch die Rechnung gemacht. Sie liebte es und konnte es gar nicht lassen, mit der Reitpeitsche auf diejenigen ihrer Bekannten und Kollegen loszugehen, mit denen sie gerade nicht in allen Stücken der gleichen Meinung oder Stimmung war: eine Angewohnheit, über die man in St.-Pauli-Kreisen sich zunächst wie über eine humoristische und niedliche Nuance ergötzte, die aber auf die Dauer gar zu originell und übrigens einfach störend wurde.
Juliette bekam ihre Entlassung und erlebte nun, in unbesorgt geschwindem Tempo, das, was man gemeinhin „von Stufe zu Stufe sinken“ nennt; das heißt: sie musste ihre Tanzkünste in immer kleineren, immer übler beleumundeten Lokalen zeigen. Ihre Einnahmen aus solcher Tätigkeit wurden nach und nach so gering, dass sie sich bald gezwungen sah, ihnen durch Nebenverdienste aufzuhelfen. Welche Beschäftigung kam in Frage, wenn nicht die des abendlichen Spaziergangs auf der Reeperbahn[30 - Reeperbahn: Vergnügungsviertel in Hamburg.] und in den benachbarten Gassen? Ihr schöner, dunkler Körper, den sie in aufrechtem, stolzem, ja fast hochmütigem Gang über das Trottoir bewegte, war wahrhaftig nicht das schlechteste Stück von diesem ungeheuren Ausverkauf der Leiber, der sich hier allnächtlich den durchreisenden Matrosen und den armen wie den ehrenwerten Männern der Stadt Hamburg bot.
Der Schauspieler Höfgen übrigens hatte die Bekanntschaft seiner Schwarzen Venus keineswegs auf dem Strich gemacht; vielmehr in der engen, vom Tabaksqualm und vom Lärm besoffener Schiffer erfüllten Kneipe, wo sie, für eine Abendgage von drei Mark, ihre dunklen, glatten Glieder und ihre kunstvoll klappernden Steps zur Schau stellte. Auf dem Programm des finsteren Kabaretts war die schwarze Tänzerin Juliette Martens als „Prinzessin Tebab“ angezeigt – ein Name, den sie nur als Künstlerin führen durfte, auf den sie aber auch im zivilen Leben Anspruch zu haben behauptete. Durfte man ihren Angaben Glauben schenken, so war ihre verstorbene Mutter, die verlassene Geliebte des Hamburger Ingenieurs, von rein fürstlichem Blute gewesen: Tochter eines veritablen, unermesslich reichen, großmütigen und leider in relativ zartem Alter von seinen Feinden verspeisten Negerkönigs. Was Hendrik Höfgen betrifft, so war er weniger von ihrem Titel beeindruckt gewesen – obwohl auch dieser ihm ganz außerordentlich gefallen hatte – als vielmehr von ihren beweglichen grausamen Augen und von den Muskeln ihrer schokoladenfarbenen Beine. Nachdem die Nummer der Prinzessin Tebab beendet gewesen war, hatte er sich in der Garderobe der Künstlerin melden lassen, um ihr seinen – zunächst vielleicht etwas überraschend klingenden – Wunsch vorzutragen: nämlich den, Tanzstunden bei ihr zu nehmen. „Heute muss ein Schauspieler trainiert sein wie ein Akrobat“, hatte Höfgen erklärend hinzugefügt; aber die Prinzessin schien nicht sehr begierig auf seine Erläuterungen. Ohne sich lang zu verwundern, hatte sie den Preis pro Stunde und das erste Rendezvous verabredet.
So war die Beziehung zwischen Hendrik Höfgen und Juliette Martens entstanden. Das dunkle Mädchen war die „Lehrerin“ – also die Herrin; vor ihr stand der bleiche Mann als der „Schüler“ – als der Gehorchende, Sich-Erniedrigende, der die häufige Strafe mit der gleichen Demut empfängt wie das seltene, karge Lob.
„Blicke mich an!“ verlangte Prinzessin Tebab und rollte schrecklich die Augen, während die seinen, zugleich begehrend und furchtsam, an ihrer gebieterischen Miene hingen.
„Wie schön du heute bist!“ brachte er schließlich hervor, wobei ihm die Lippen nur mühsam zu gehorchen schienen.
Sie fuhr ihn an: „Lass den Unsinn! Ich bin nicht schöner als sonst.“ Dabei strich sie sich aber doch eitel über den Busen und zupfte ihr enges, plissiertes Röckchen zurecht, das kurz oberhalb der Knie endete. Vom schwarzen Seidenstrumpf war nur ein knappes Stück sichtbar; denn die grünen Schaftstiefel aus geschmeidigem Lackleder reichten bis über die Waden. Zu den prächtigen Stiefeln und dem kurzen Rock trug die Prinzessin ein graues Pelzjäckchen, dessen Kragen im Nacken hochgeschlagen war. An den dunklen, sehnigen Handgelenken klirrten breite Armbänder aus gemeinem Goldblech. Das eleganteste Stück ihrer Ausstattung war die Reitpeitsche – ein Geschenk Hendriks. Sie war leuchtend rot, aus geflochtenem Leder. Juliette klopfte mit ihr, in einem kurzen, harten und drohenden Rhythmus, gegen die grünen Schaftstiefel.
„Du bist wieder eine Viertelstunde zu spät“, sagte sie, nach einer langen Pause, die niedrige und zu zwei kleinen Buckeln gewölbte Stirne in böse Falten gelegt. „Wie oft soll ich dich noch warnen, mein Süßer?“ fragte sie tückisch leise, um dann in unvermitteltem Zorne loszubrechen: „Es ist genug!! Ich habe es satt!! Gib mir deine Pfoten!“
Hendrik hob langsam die beiden Hände, deren Innenflächen er nach oben wandte. Dabei ließ er seine hypnotisierten, aufgerissenen Augen nicht von der ergrimmten, schauerlichen Fratze der Geliebten.
Sie zählte mit einer grellen, plärrenden Stimme: „Eins, zwei, drei!“, während sie zuhieb. Das Geflecht der eleganten Peitsche pfiff grausam quer über seine Handllächen, auf denen sofort dicke rote Striemen entstanden. Der Schmerz, den er empfand, war so heftig, dass er ihm das Wasser in die Augen trieb. Er verzog den Mund; beim ersten Schlag schrie er leise; dann beherrschte er sich und stand mit einem starren, weißen Gesicht.
„Für den Anfang hast du genug“, sagte sie und zeigte plötzlich ein müdes Lächeln, welches durchaus gegen die Spielregeln ging: es hatte nichts fratzenhaft Grausames, sondern enthielt gutmütigen Spott und ein wenig Mitleid. Sie ließ die Peitsche sinken, wandte den Kopf und stand – das Gesicht im Profil – in einer schönen, traurigen Haltung. „Zieh dich um!“ sagte sie leise. „Wir wollen arbeiten.“
Es gab keinen Paravent, hinter dem er hätte verschwinden können, als er die Kleidung wechselte. Unter halbgesenkten Lidern, mit einem übrigens völlig uninteressierten Blick, beobachtete Juliette jede seiner Bewegungen. Er musste alles ablegen und ihr seinen hellen, schon etwas zu fetten, rötlich behaarten Körper zeigen, ehe er in den ärmellosen, blau und weiß gestreiften Sweater und in das schwarze Turnhöschen schlüpfte. Schließlich stand er vor ihr in der unwürdigen Tracht, die er seinen „Trainingsanzug“ nannte – in der kindischen und ridikülen Aufmachung, bestehend aus schwarzen, ausgeschnittenen Halbschuhen mit weißen Söckchen, die oberhalb der Knöchel kokett umgerollt waren; aus dem kurzen Höschen von glänzend schwarzem Satin – wie die kleinen Buben es in der Turnstunde tragen – und dem gestreiften Hemd, das Hals und Arme entblößt ließ.
Sie musterte ihn, kritisch und kalt. „Du bist seit voriger Woche noch etwas dicker geworden, mein Süßer“, konstatierte sie, wobei sie mit der Peitsche höhnisch gegen ihre grünen Stiefel klopfte. „Entschuldige“, bat er leise.
Die Schwarze machte sich am Grammophon zu schaffen. In die Jazzmusik hinein, deren rhythmischer Lärm plötzlich einsetzte, sagte sie rauh: „Fang schon an!“ Dabei fletschte sie die beiden Reihen ihrer gar zu weißen Zähne und bewegte grimmig die Augen: Dies genau war das Mienenspiel, das er jetzt von ihr erwartete und verlangte.
Ihr Gesicht stand vor ihm wie die schreckliche Maske eines fremden Gottes: Dieser thront mitten im Urwald, an verborgener Stelle, und was er fordert mit seinem Zähneblecken und Augenrollen, das sind Menschenopfer. Man bringt sie ihm, zu seinen Füßen spritzt Blut, er schnuppert mit der eingedrückten Nase den süß vertrauten Geruch, und er wiegt ein wenig den majestätischen Oberkörper nach dem Rhythmus des wild bewegten Tamtams; Um ihn vollführen seine Untertanen den verzückten Freudentanz. Sie schleudern die Arme und Beine, sie hüpfen, schaukeln sich, taumeln; aus ihrem Gebrüll wird Wonnegestöhn, aus dem Gestöhn wird ein Keuchen, und schon sinken sie hin, lassen sich lallen vor die Füße des schwarzen Gottes, den sie lieben, den sie ganz bewundern – wie Menschen nur den lieben und ganz bewundern können, dem sie das Kostbarste geopfert haben: Blut.
Hendrik hatte langsam zu tanzen begonnen. Aber wohin war die triumphale Leichtigkeit, die von Publikum und Kollegen an ihm bewundert wurde? Sie war verschwunden; nur unter Qualen schien er jetzt die Füße zu setzen – freilich unter Qualen, die auch Wonnen waren: dies verrieten das selbstvergessene Lächeln der fahlen, aufeinandergepressten Lippen und der benommene Blick.
Juliette ihrerseits dachte nicht daran, zu tanzen; sie ließ den Schüler sich alleine plagen. Nur durch Händeklatschen, rauhe Schreie und rhythmisches Schaukeln des Leibes feuerte sie ihn an. „Schneller, schneller!“ forderte sie wütend. „Was hast du denn in den Knochen? Und du willst ein Mann sein?! Du willst ein Schauspieler sein und dich auch noch für Geld sehen lassen? – Da, du komisches Stückchen Elend…“
Die Peitsche fuhr ihm über die Waden und über die Arme. Diesmal traten ihm keine Tränen in die Augen, welche trocken und glühend blieben. Nur seine zusammengepressten Lippen zitterten. Prinzessin Tebab schlug noch einmal zu.
Er arbeitete, ohne jede Unterbrechung, eine halbe Stunde lang, als handelte es sich um ein ernsthaftes Training anstatt um eine etwas schauerliche Lustbarkeit. Schließlich keuchte er heftig. Er taumelte. Sein Gesicht war schweißbedeckt. Mühsam brachte er hervor: „Mir ist schwindlig. Darf ich aufhören…?“
Sie erwiderte, mit einem Blick auf die Uhr, kurz und sachlich: „Mindestens noch eine Viertelstunde musst du springen.“
Da die Musik wieder plärrte und Juliette wieder frenetisch in die Hände klatschte, versuchte er noch einmal den komplizierten Step. Aber die gequälten Füße, in ihren koketten Halbschuhen und Söckchen, verweigerten ihm den Dienst. Hendrik schwankte eine Sekunde lang; stand darin still; wischte sich mit der zitternden Hand den Schweiß von der Stirne.
„Was machst du für Scherze?“ grollte sie. „Du hörst auf, ohne meine Erlaubnis?! Das wäre ja das Allerneueste und noch das Schönere!“
Sie zielte mit der roten Peitsche nach seinem Gesicht; er duckte sich noch rechtzeitig, um diesem fürchterlichen Schlage zu entgehen. Abends ins Theater kommen mit einer blutigen Strieme von der Stirn bis zum Kinn: das wäre denn doch etwas zuviel gewesen. Trotz der benommenen Stimmung, in der er sich befand, blieb ihm klar, dass er sich dergleichen keinesfalls leisten durfte. „Lass das!“ sagte er kurz. Während er sich schon von ihr abwendete, fügte er noch hinzu: „Genug für heute.“
Sie verstand, dass dies kein Spaß mehr war. Ohne etwas zu antworten, mit einem erleichterten kleinen Seufzer, schaute sie ihm zu, wie er in seinen üppig gefütterten, rotseidenen, übrigens an mehreren Stellen zerrissenen Schlafrock schlüpfte und sich auf dem Ruhebett niederließ.
Das Sofa, welches man für die Nacht als Bett herrichten konnte, war tagsüber bedeckt mit Tüchern und bunten Kissen. Neben dem Kanapee[31 - Kanapee: Sofa, Couch.] stand die Lampe auf dem runden, niedrigen Rauchtisch.
„Mach das grelle Licht aus!“ bat Hendrik mit der singenden, wehleidigmelodischen Stimme. „Und komme zu mir, Juliette!“
Durch das rosige Halbdunkel schritt sie auf ihn zu. Als sie neben ihm stehenblieb, seufzte er leise: „Wie gut!“
„Hat es dir Spaß gemacht?“ fragte sie ziemlich trocken. Sie hatte sich eine Zigarette angezündet und reichte auch ihm Feuer; er benutzte zum Rauchen die lange, ordinäre Zigarettenspitze, das Geschenk der Rahel Mohrenwitz. „Ich bin völlig erledigt“, sagte er. Daraufhin verzog sie ihren gewaltigen Mund zu einem gutmütigen und verständnisvollen Lächeln. „Das ist recht“, sagte sie, wobei sie sich über ihn beugte.
Er hatte seine breiten, bleichen, rötlich behaarten Hände auf ihre edlen, von schwarzer Seide überglänzten Knie gelegt. Träumerisch sprach er: „Wie hässlich meine gemeinen Hände auf deinen herrlichen Beinen aussehen, Geliebte!“
„An dir ist alles hässlich, mein Schweinchen – Kopf, Füße, Hände, und alles!“ versicherte sie ihm mit einer knurrenden Zärtlichkeit.
Sie ließ sich neben ihn hingleiten. Das graue Pelzjäckchen hatte sie abgelegt; darunter trug sie eine knappe, hemdartige Bluse aus einem stark glänzenden, rot und schwarz karierten Seidenstoff.
„Ich werde dich immer lieben“, sagte er erschöpft. „Du bist stark. Du bist rein.“
Dabei schaute er, unter gesenkten Lidern, auf ihre harten und spitzen Brüste, die sich unter dem eng anliegenden, dünnen Gewebe deutlich abhoben.
„Ach, das sagst du nur so“, meinte sie ernst und ein wenig verächtlich. „Das bildest du dir nur ein. Manche Leute haben das – dass sie sich immer so was einbilden müssen. Sonst fühlen sie sich nicht wohl.“
Er tastete mit seinen Fingern nach ihren hohen und geschmeidigen Stiefeln. „Aber ich weiß doch, dass ich dich immer lieben werde“, flüsterte er, nun mit geschlossenen Augen. „Nie wieder finde ich eine Frau wie dich. Du bist die Frau meines Lebens, Prinzessin Tebab.“ Sie wiegte misstrauisch ihr dunkles, ernstes Gesicht über seinem weißen, ermüdeten. „Und dabei darf ich nicht einmal ins Theater gehen, wenn du spielst“, sagte sie unzufrieden.
Er hauchte: „Trotzdem spiele ich nur für dich – nur für dich, meine Juliette. Ich hole bei dir meine Kraft.“
„Aber ich lasse mir’s nicht verbieten“, sagte sie trotzig. „Ich gehe ins Theater, ob du es mir erlaubst oder nicht. Nächstens einmal sitze ich im Parkett, und dann lache ich laut, wenn du auf die Bühne kommst, mein Affe.“
Er sagte hastig: „Mach keine Witze!“ Dabei hatte er erschreckt die Augen geöffnet und sich halb aufgerichtet. Der Anblick seiner Schwarzen Venus schien ihn wieder zu beruhigen. Er lächelte, und nun begann er sogar zu rezitieren.
„Vienstu du ciel profond ou sorstu de l’abîme – o Beauté?“[32 - Kommst du vom Himmel, steigst du auf aus tiefen Schlünden, o Schönheit?]
„Was ist denn das für ein Quatsch?“ fragte sie ungeduldig.
„Das ist aus diesem herrlichen Buch da“, erklärte er ihr, und deutete auf eine gelb broschierte französische Edition, die neben der Lampe auf dem Rauchtisch lag – es waren „Les Fleurs du Mal“ von Baudelaire.
„Das verstehe ich nicht“, sagte Juliette verdrossen. Er aber ließ sich nicht stören in seiner Ekstase, sondern fuhr fort:
„Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu temoques;
De tes bijoux l’Horreur n’est pas le moins charmant,
El le Meurtre, parmi l es plus chères breloques,
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement.“[33 - Dein Weg, o Schönheit, führt dich spottend über Leichen,Das Graunen dient dir als Geschmeid und schenkt dir Lust,Doch mit dem Mord kann sich kein anderer Schmuckvergleichen,Er tanzt als Kronjuwel verliebt auf deiner Brust.Charles Baudlaire „Les Fleurs du Mal“ (Die Blumen des Bösen); aus der „Hymne à la Beauté (Hymne an die Schönheit) in der Übersetzung von Carl Fischer.]
„Wie magst du nur so blöd lügen“, sagte sie und berührte mit ihrem dunklen und schlanken Finger seinen redenden Mund.
Er aber sprach weiter, immer mit demselben, melancholisch singenden Ton: „Du erzählst mir nie davon, wie du früher gelebt hast, Prinzessin Tebab. Ich meine: in deinem Erdteil…“
„Ich kann mich an nichts mehr erinnern“, sagte sie kurz. Dann küsste sie ihn – vielleicht nur, um ihn daran zu hindern, noch länger indiskrete und poetische Fragen zu stellen: ihr weit geöffneter, tierischer Mund mit den dunklen, rissigen Lippen und der blutroten Zunge näherte sich langsam seinem gierigen, fahlen Mund.
Sowie sie ihr Gesicht wieder von dem seinen erhoben hatte, redete er weiter. „Ich weiß nicht, ob du mich vorhin verstanden hast, als ich sagte, dass ich nur für dich und nur durch dich spiele.“ Während er so weich und träumerisch sprach, führte sie ihre geübten Finger durch sein schütteres Seidenhaar, auf dessen Fahlheit die Lampe ein wenig Goldglanz zauberte. Sie behandelte sein feines Haar auf eine nicht eigentlich zärtliche, sondern auf eine ernste und sachliche Art, als wollte sie es frisieren. „Ich habe es ganz wörtlich gemeint“, fuhr er fort. „Wenn ich den Leuten ein bisschen gefalle, wenn ich Erfolg habe – dir verdanke ich ihn. Dich zu sehen, dich zu berühren, Prinzessin Tebab: das ist wie eine Wunderkur für mich… etwas Herrliches, eine Erfrischung ganz ohnegleichen…“
„Ach, wenn du nur immer schwatzen und lügen kannst“, sagte sie mütterlich. „Du bist doch der drolligste kleine Dreckhaufen, dem ich jemals begegnet bin.“ Sie hatte, um ihn nur zum Schweigen zu bringen, ihre beiden Hände auf sein Gesicht gelegt; die breiten Armbänder klirrten an seinem Kinn; auf seinen Wangen ruhten die hellen Innenflächen ihrer Hände. Da endlich verstummte er. Er rückte seinen Kopf auf dem Kissen zurecht, als wollte er einschlafen. Gleichzeitig schlang er mit einer hilfesuchenden Gebärde seine beiden Arme um das schwarze Mädchen. Während sie ganz still in seiner Umarmung hielt, ließ sie die Hände auf seinem Gesicht liegen, als müsste sie ihn davor bewahren, das zärtlichhöhnische Lächeln zu sehen, mit dem sie jetzt auf ihn niederblickte.
III
Knorke
Die Saison ging weiter, es war keine schlechte Saison für das Hamburger Künstlertheater. Oskar H. Kroge war entschieden ungerecht gewesen, als er gesagt hatte, Höfgen werde überzahlt mit tausend Mark Monatsgehalt. Ohne diesen Schauspieler und Regisseur hätte das Institut gar nicht auskommen können; er leistete Enormes, war so unermüdlich wie einfallsreich. Er spielte alles, jugendliche Rollen und alte: nicht nur Miklas hatte Anlass, auf ihn eifersüchtig zu sein, sondern auch Petersen, und sogar Otto Ulrichs hätte ihn gehabt; aber der war mit wichtigeren Dingen beschäftigt und nahm den bürgerlichen Theaterbetrieb nicht ganz ernst. Höfgen gewann sich die Kinderherzen als witziger und schöner Prinz im Weihnachtsmärchen; die Damen fanden ihn unwiderstehlich in französischen Konversationsstücken und in den Komödien von Oscar Wilde[34 - Wilde, Oscar (
1854, †1900), irischer Schriftsteller, schrieb geistreiche Gesellschaftsstücke, Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“, Märchen, Gedichte.]; der literarisch interessierte Teil des Hamburger Publikums diskutierte seine Leistungen in „Frühlings Erwachen“, als Advokat in Strindbergs „Traumspiel“, als Leonce in Büchners „Leonce und Lena“. Er konnte elegant sein, aber auch tragisch. Er hatte das „aasige“ Lächeln, aber auch den Leidenszug an den Schläfen. Er bezauberte mit übermütigem Esprit, er imponierte mit herrisch gerecktem Kinn, abgehacktem Kommandoton und stolznervösen Gebärden; er rührte durch Demut, hilflos irrenden Blick, weltfremd zarte Verstörtheit. Er war gütig oder gemein, hochfahrend oder zärtlich, schneidig oder gebrochen – ganz wie das Repertoire es verlangte. In Schillers „Kabale und Liebe“ spielte er abwechselnd den Major Ferdinand und den Sekretarius Wurm, den überschwenglichen Liebhaber und den ruchlosen Intriganten: dabei hätte er es kaum nötig gehabt, seine Wandlungsfähigkeit, an der niemand zweifelte, solcherart kokett zu betonen. Vormittags hatte er Proben zum „Hamlet“, nachmittags zu einer Posse „Mieze macht alles“. Die Posse kam zum Silvesterabend[35 - Silvester: der letzte Tag des Jahres, der 31. Dezember.] heraus und wurde ein starker Erfolg. Schmilz konnte zufrieden sein; über den „Hamlet“ raste Kroge, der noch auf der Generalprobe die Aufführung untersagen wollte. „Eine solche Schweinerei habe ich niemals geduldet in meinem Hause!“ empörte sich der alte Vorkämpfer des literarischen Theaters. „Hamlet erledigt man nicht nebenbei wie einen Reißer“. Höfgen erledigte ihn; sah sehr eindrucksvoll aus in seiner hochgeschlossen en schwarzen Tracht, mit rätselhaft schielenden Augen und fahlem Leidensgesicht, und bekam am nächsten Vormittag von der Hamburger Presse versichert, dass es eine interessante Leistung gewesen sei, nicht ganz durchgearbeitet vielleicht, etwas improvisiert, aber doch voll packender Momente. Angelika Siebert hatte die Ophelia spielen dürfen und war auf jeder Probe schier zerflossen vor Tränen; bei der Premiere hatte sie wegen heftigen Weinens kaum auftreten können. Übrigens fanden dann einige Kenner, ihre Leistung sei eigentlich die beste gewesen in dieser bedenklichen Inszenierung.
Höfgen arbeitete sechzehn Stunden am Tag und hatte jede Woche mindestens einen Nervenzusammenbruch. Diese Krisen traten stets sehr heftig und in abwechslungsreichen Formen auf. Einmal fiel Höfgen zur Erde und zuckte stumm; das nächste Mal hingegen blieb er zwar stehen, schrie aber grauenhaft, und dies fünf Minuten lang ohne jegliche Unterbrechung; dann wieder behauptete er auf der Probe, zum Entsetzen aller, er bekomme plötzlich seine Kiefer nicht mehr auseinander, ein Krampf habe eingesetzt, es sei scheußlich, nun könne er nur noch murmeln, und das tat er denn auch. Vor der Abendvorstellung, in der Garderobe, ließ er sich von Bock – der seine sieben Mark fünfzig noch immer nicht wiederhatte – die untere Gesichtshälfte massieren, stöhnte und murmelte mit aufeinandergepressten Zähnen. Eine Viertelstunde später, auf der Bühne, gehorchte ihm sein Mundwerk wie je; er benutzte es mit Geschicklichkeit, strahlte und hatte Erfolg.
Die kleine Angelika litt; Höfgen kümmerte sich nicht darum. Frau von Herzfeld litt; er speiste sie ab mit intellektuellen Konversationen. Rolf Bonetti litt, um der kleinen Angelika willen, die spröde blieb, wie eigensinnig und eifrig er sich auch um sie bewarb; so musste sich der schöne junge Liebhaber mit Rahel Mohrenwitz trösten: dieses tat er widerwillig und ohne dass darum die angeekelten Züge verschwunden wären aus seinem Gesicht. Hans Miklas hasste; hungerte – wenn die Efeu ihm nicht gerade Butterbrote schenkte —; schimpfte mit seinen politischen Freunden auf Marxisten, Juden und Judenknechte; trainierte zäh, bekam kleine Rollen und unterhalb der Backenknochen immer schwärzere Löcher.
Mit seinen politischen Freunden steckte auch Otto Ulrichs viel zusammen. Gerade vor ihnen war es ihm peinlich, dass die Eröffnung des Revolutionären Theaters immer wieder hinausgeschoben wurde. Jede Woche erfand Höfgen eine andere Ausrede. Es geschah häufig, dass Ulrichs nach der Probe den Freund beiseite nahm, um zu flehen: „Hendrik! Wann fangen wir an!“ Dann redete Höfgen, schnell und leidenschaftlich, von der Verwerflichkeit des Kapitalismus, vom Theater als politischem Instrument, von der Notwendigkeit einer kraftvollen, durchgearbeiteten, künstlerisch-politischen Aktion, und versprach schließlich, unmittelbar nach der Premiere von „Mieze macht alles“ mit den Proben für das Revolutionäre Theater zu beginnen.
Jedoch ging die stimmungsvolle Silvesterpremiere vorüber; viele andere Premieren folgten, die Saison nahte sich ihrem Ende, sie war fast vorbei: vom Revolutionären Theater gab es noch immer nicht mehr als das schöne Briefpapier, auf dem Höfgen eine hochgestimmte und verzweigte Korrespondenz mit prominenten Autoren sozialistischer Gesinnung führte. Als Otto Ulrichs wieder einmal bat und drängte, erklärte Hendrik ihm, für diese Saison sei es, tief bedauerlicherweise und infolge eines Zusammenkommens von fatalsten Umständen, zu spät geworden: man müsse leider bis zum nächsten Herbst warten. Diesmal verfinsterte sich Ulrichs Miene; Hendrik aber legte dem Freund und Gesinnungsgenossen den Arm um die Schulter und redete auf ihn ein mit jener durchaus unwiderstehlichen Stimme, die erst sang und bebte, dann heftig und schneidend wurde; denn nun geißelte Höfgen die moralische Verkommenheit der Bourgeoisie und pries die internationale Solidarität des Proletariats. Ulrichs war zu versöhnen. Man trennte sich mit langem Händedruck.
Damals wurde eben die letzte Novität für diese Spielzeit vorbereitet: in Theophil Marders Komödie „Knorke“ sollte Hendrik Höfgen die Hauptrolle spielen. Das gesellschaftskritischdramatische Werk Marders hatte großen Ruhm; alle Kenner priesen seine höchst persönlich geprägte Form, seine unfehlbare Bühnenwirksamkeit und geistvoll unbarmherzige Bosheit. Zu der „Knorke“-Uraufführung würden die Kritiker aus Berlin herbeigereist kommen. Übrigens erwartete man auch den Autor – nicht ohne Herzklopfen; denn Marders unerbittlich hohe Meinung von sich selber war ebenso bekannt wie seine grimmige Schnoddrigkeit und seine Neigung zu jäh aus dem Nichts geholten heftigen und dauerhaften Streitigkeiten.
Bei aller Angst aber freute sich Höfgen auch auf die Ankunft des berühmten Dramatikers; er zweifelte kaum daran, dass dem Hellsichtigen und Erfahrenen seine Leistung auffallen werde. „Ich muss gut werden in ,Knorke’!“ schwor Hendrik sich.
Damit er sich nur ganz der Rolle widmen konnte, überließ er dieses Mal die Regie dem Direktor Kroge, der ein alter Spezialist für die Komödien des Theophil Marder war. „Knorke“ gehörte in einen Zyklus von satirischen Stücken, die das deutsche Bürgertum unter Wilhelm II.[36 - Wilhelm II. (
1859, †1941), deutscher Kaiser und König von Preußen; erzwang 1890 den Rücktritt Otto von Bismarcks, liebte forsches Auftreten und äußeren Pomp; wurde durch seine Unbedachtheit dem selbst auferlegten Führungszwang nicht gerecht. Am 9.11.1918 wurde in Berlin seine Abdankung verkündet, er ging in die Niederlande.] schilderten und verhöhnten. Held der Komödie war der Emporkömmling, der mit dem zynisch verdienten Geld, mit dem ordinären Elan seines Wesens und einer skrupellosen, niedrigen, selbstbewussten Intelligenz sich Macht und Einfluss in den höchsten Kreisen erobert. Knorke war grotesk, aber auch imposant. Er repräsentierte den parvenühaft-emporschießenden, vitalen, ganz dem Geist entfremdeten bourgeoisen Typus. Höfgen versprach großartig zu werden in dieser Rolle. Er hatte ihre grausam schneidenden Akzente und zuweilen ihre beinah rührende Hilflosigkeit. Keine Frage: Höfgen musste Sensation machen in diesem Stück.
Seine Partnerin, Knorkes Lebensgefährtin, die nicht weniger skrupellos ist als er selber, und schwächer nur dadurch, dass sie liebt: dass sie Knorke liebt – seine Partnerin in der genialen Komödie spielte ein junges Mädchen, das von Theophil Marder in energisch oder beinah zornig abgefassten Briefen dringend empfohlen worden war. Nicoletta von Niebuhr besaß noch wenig praktische Theatererfahrung – nur ganz selten war sie aufgetreten, und dies in kleineren Städten —; aber ein selbstsicheres, fast einschüchterndes Wesen. Marder hatte dem armen Oskar H. Kroge in krassen Ausdrücken mit dem grässlichsten Skandal gedroht, falls die Direktion des Künstlertheaters Fräulein von Niebuhr nicht für ein erstes Fach engagieren würde. Kroge, der vor des Dramatikers fürchterlicher Diktion klein und ängstlich wurde, ließ Nicoletta in „Knorke“ probeweise gastieren. Sie kam angereist, mit vielen Handkoffern aus rotem Lackleder, einem breitrandigen schwarzen Herrenhut zu einem brennend roten Gummimantel, einer großen gebogenen Nase und leuchtenden Katzenaugen unter einer hohen, schönen Stirn. Alle bemerkten sogleich, dass sie eine Persönlichkeit war: die Motz konstatierte es mit ehrfurchtsvoll bewegter Stimme im H. K., und niemand mochte ihr widersprechen, selbst Rahel Mohrenwitz nicht, obwohl diese sich über die Ankunft der Neuen ärgerte; denn ganz entschieden war auch Nicoletta eine dämonische junge Dame, sie brauchte weder Monokel noch lange Zigarettenspitze, um es der Welt zu beweisen.
Rolf Bonetti und Petersen diskutierten darüber, ob Nicoletta schön zu nennen sei. Der enthusiastische Petersen fand sie „einfach blendend“; der vorsichtige Kenner Bonetti wollte sie nur als „interessant“ bezeichnet wissen. „Von schön kann doch gar nicht die Rede sein, bei der Nase!“ sagte er wegwerfend. „Aber ihre Augen sind herrlich“, schwärmte Petersen, wobei er um sich blickte, ob die Motz nicht in der Nähe war. „Und wie sie sich hält! Majestätisch, möchte man beinah sprechen!“ – Draußen ging Nicoletta vorbei, Arm in Arm mit Höfgen, was viel bemerkt ward. Ihr Kopf mit der kühnen Nase, dem leuchtenden Blick und der großen Stirn glich dem eines Renaissance-Jünglings: dies stellte, mit leidvoller. Einsicht, Frau von Herzfeld fest, die das Paar eifersüchtig verfolgte. Nicoletta hielt sich sehr gerade. Ihre grell geschminkten, scharfen Lippen formten die Worte mit einer schneidenden Präzision; jeder Satz klirrte vor Akkuratesse; die Vokale sprach sie ganz weit vorn, so dass sie blank und flach klangen, kein Konsonant ging verloren, noch die beiläufigste Floskel wurde zum Triumph der Sprachtechnik.
Gerade war Nicoletta dabei, mit dämonischer Sorgfalt zu betonen, dass sie ehrgeizig sei, und, wenn es sein müsse, auch intrigant. „Natürlich, mein Liebling!“ sagte sie schneidend zu Höfgen, den sie seit ein paar Stunden kannte. „Vorwärtskommen wollen wir alle. Man muss Ellenbogen haben.“ Hendrik, der sie sich neugierig von der Seite beschaute, dachte darüber nach, ob sie in diesem Augenblick aufrichtig sei oder posierte. Es war schwer zu entscheiden. Vielleicht war gerade dieser radikal entschlossene Zynismus die Maske, hinter der sie ein ganz anderes Gesicht verbarg. Wer wusste aber, ob dieses andere versteckte Gesicht auch eine so kühne Nase und einen so scharfen Mund hatte wie die Miene, die sie jetzt mit Stolz zur Schau trug?
Hendrik konnte sich nicht verhehlen, dass die Frau an seiner Seite ihm Eindruck machte. Ohne Frage, sie war die erste, seitdem er Juliette kannte, für die er einen beteiligten, interessierten Blick hatte. Er beichtete es der Schwarzen Venus noch am selben Tage und bekam furchtbare Schläge – die diesmal nicht aus rituellen Gründen und weil es so zum Spiel gehörte verabreicht wurden, sondern aus Überzeugung und mit echter Leidenschaft; denn Prinzessin Tebab ärgerte sich. Hendrik litt, stöhnte, genoss und versicherte am Ende seiner Prinzessin, dass sie die eigentliche Herrin und Geliebte bleiben würde. Als er aber Nicoletta wiedersah, faszinierten ihn wieder ihre schneidende Sprechweise, ihr blanker, durchdringender Blick und ihre stolz zusammengenommene Haltung.
Es gefiel ihm auch, was sie ihm in präziser Sprache über ihre Herkunft und Vergangenheit anvertraute. Ihm imponierte das Exzentrische, Abenteuerlich-Fragwürdige, da er selbst aus den bürgerlichsten Verhältnissen kam. Nicoletta erzählte, dass sie ihre Eltern nicht gekannt habe. „Mein Papa war ein Hochstapler“, konstatierte sie erhobenen Hauptes, fröhlich und stolz. „Mama ist eine kleine Tänzerin an der Pariser Oper gewesen, sehr dumm, wie ich höre; aber sie soll die himmlischsten Beine gehabt haben.“ Sie blickte herausfordernd auf ihre eigenen, mit denen sie nur angab, als wären sie himmlisch. „Papa war ein Genie. Immer verstand er es, auf größtem Fuß zu leben. Er ist in China gestorben, wo er siebzehn Teehäuser und enorme Schulden hinterließ. Das einzige Andenken, das ich an ihn besitze, ist seine Opiumpfeife.“ In ihrem Hotelzimmer wies sie Hendrik die Reliquie vor. Mit einer Korrektheit, hinter der man lauter Teufelei vermuten musste, fragte sie ihn, ob er Tee haben wollte oder Kaffee. Die Bestellung rief sie durch das Telefon dem Kellner zu wie einen fürchterlichen, mit eisiger Mitleidlosigkeit vorgebrachten Urteilsspruch. Dann erzählte sie ausführlich von ihrer Jugend. „Gelernt habe ich gar nicht viel“, sagte sie. „Aber ich kann auf den Händen gehen, auf einer rollenden Kugel laufen und wie eine Eule schreien.“ Ihre Fibel sei die sehr empfehlenswerte Zeitschrift „La Vie Parisienne“ gewesen. Aufgewachsen war sie teils in französischen Internaten, aus denen man sie wegen fürchterlicher Ungezogenheit stets bald wieder entfernt hatte; teils im Hause des Geheimrats Bruckner, den sie einen Jugendfreund ihres Vaters nannte.
Vom Geheimrat Bruckner hatte Höfgen schon gehört. Die Werke des Historikers waren berühmt; übrigens kannte Hendrik sie nicht. Hingegen wusste er, dass des Geheimrats gesellschaftliche Stellung ebenso bedeutend wie ungewöhnlich war. Der Forscher und Denker war nicht nur eine der exponiertesten und meistbesprochenen Figuren der deutschen und europäischen akademisch-literarischen Welt; man sagte ihm auch intime und einflussreiche Verbindungen zu politischen Kreisen nach. Seine Freundschaft mit. einem sozialdemokratischen Minister war bekannt; andererseits hatte er Beziehungen zur Reichswehr: seine verstorbene Frau war die Tochter eines Generals gewesen. Viel Anlass zu Kommentaren hatte eine Vortragstournee des Geheimrats durch Sowjetrussland gegeben. Damals war von der nationalistischen Presse die große Hetze gegen ihn eröffnet worden. Seitdem stellte man gerne mit Erbitterung fest, die Geschichtsbetrachtung Bruckners sei marxistisch beeinflusst. Es geschah, dass die Studenten lärmten, als er das Katheder betrat. Seine Weltgeltung und seine ruhige, überlegene Haltung schüchterten die Aufgeregten ein. Der Geheimrat ging siegreich hervor aus den Skandalen. Er blieb unantastbar.
„Der Alte ist wundervoll“, sagte Nicoletta von ihm. „Er versteht auch etwas von Menschen; an Papa zum Beispiel hatte er eine große Anhänglichkeit. Deshalb ließ er sich von mir immer alles gefallen – und ich meinerseits hatte Geduld mit seiner feinen Langweiligkeit.“
Nicolettas beste Freundin, ihre eigentliche Schwester, war Barbara, Bruckners Tochter. „Ein so schönes Geschöpf! Und so gut!“ Nicolettas Blick wurde weicher, während sie dies sagte; aber auf die klirrend exakte Aussprache konnte sie nicht verzichten. – Zu der „Knorke“-Premiere wurde nicht nur Theophil Marder erwartet, sondern auch das Mädchen Barbara. „Ich bin neugierig, ob du sie mögen wirst“, sagte Nicoletta zu Hendrik. „Vielleicht liegt sie dir nicht besonders. Aber sei bitte nett zu ihr, mir zu Gefallen. – Sie ist etwas scheu“, stellte Nicoletta fest und schmetterte die Vokale.
Am Tag der großen Premiere traf Barbara Bruckner ein; Marder kam erst gegen Abend, mit dem Berliner Schnellzug. Höfgen machte Barbaras Bekanntschaft, als er, unmittelbar vor Beginn der Vorstellung, einen Kognak in der Kantine trank. Nicoletta sprach mit musterhafter Deutlichkeit und greller Stimme: „Dieses ist meine liebste Freundin, Barbara Bruckner!“ – wozu sie eine zeremonielle Geste unter dem schwarzen, steif plissierten Cape vollführte. Hendrik war zu aufgeregt, um sich das junge Mädchen genauer zu betrachten. Er stürzte seinen Kognak hinunter und verschwand. In der Garderobe fand er zwei große Blumensträuße: weißen Flieder von Angelika Siebert, und von der Herzfeld zart teegelb getönte Rosen. Um sich durch ein gutes Werk die Gunst des Himmels zusichern, überreichte Höfgen dem kleinen Bock – der vor Premieren stets etwas weinerlich aussah – mit großer Geste fünf Mark, wodurch freilich die Sieben-Mark-fünfzig-Schuld noch immer nicht völlig getilgt war.
Die Uraufführung der Komödie „Knorke“ verlief glänzend: Marders beißende Pointen schlugen knallend ein, die steile Führung des Dialogs kitzelte das Publikum zu halb entsetzten, halb beglückten Gelächtern, vor allem aber begeisterte das exakte, schnoddrig-pathetische, in jeder Hinsicht blendende Zusammenspiel zwischen Höfgen und der neuen Kraft, Nicoletta von Niebuhr, die „auf Engagement gastierte“. Nach dem zweiten Akt mussten die beiden Hauptdarsteller sich dem animierten Saal häufig zeigen. In der Pause erschien Theophil Marder bei Höfgen, Nicoletta geleitete ihn.
Marders unruhiger, aber durchdringender Blick musterte alle Gegenstände in der Garderobe, zuletzt Hendrik selbst, der erschöpft vorm Spiegel saß. Nicoletta war, respektvoll schweigend, an der Tür stehengeblieben. Nach langer Pause sagte Marder mit. einer penetranten Kommandostimme: „Sie sind ja ’ne dolle Type!“ Seine grausam fixierenden Augen wichen nicht von Hendriks schön geschminktem Gesicht.
„Sind Sie zufrieden, Herr Marder?“ Höfgen suchte den Satiriker durch Juwelenblicke und angegriffenes Lächeln zu bezaubern. Theophil aber sagte: „Na ja…“ und fügte unverschämt hinzu; „Na ja, Herr – wie war doch der Name?“ Nun war Hendrik doch etwas beleidigt; trotzdem nannte er seinen Namen mit der singendwerbenden Stimme. Daraufhin machte Marder: „Hendrik – Hendrik – ulkiger Name, muss ich schon sagen, sehr ulkig!“: so höhnisch, dass es Höfgen eisig über den Rücken lief. Plötzlich aber rief der Dichter mit einer beängstigenden Fröhlichkeit: „Hendrik! Wieso Hendrik?! Natürlich heißen Sie eigentlich Heinz! – Heißt eigentlich Heinz, nennt sich Hendrik! Hahaha, das ist aber mal gut!“ Er lachte gellend, herzlich und ausführlich. Höfgen, aus Entsetzen über so viel böse Hellsicht, war bleich geworden unter seiner rosigen Maske und zitterte. Nicoletta, ohne einzugreifen, schaute mit blanken Katzenaugen amüsiert vom einen zum andern. Theophil war schon wieder ernst. Er schien nachzudenken; dabei bewegte er ununterbrochen den bläulichen Mund unter dem schwarzen Schnurrbart. Das erregte Spiel seiner Lippen erinnerte auf eine unheimliche Art an das gierige Saugen fleischfressender Pflanzen oder schnappender Fischmäuler. Abschließend sagte Marder: „Sind aber ’ne dolle Type. Starkes Talent – rieche das, habe verdammt feine Nase. Sprechen uns noch. Essen nachher zusammen. Komm, Kind!“ Er nahm Nicoletta am Arm und verließ die Garderobe. Höfgen blieb im Zustand völliger Konsterniertheit zurück.
Er gewann seine Fassung erst wieder, als er auf der Bühne und im Rampenlicht stand – dort freilich völlig. Im dritten Akt übertraf er alles, was er an bravourösem Elan bis dahin jemals öffentlich gezeigt hatte. Das Auditorium raste, nachdem der Vorhang gefallen war. Nicoletta, die Arme voll Blumen, fiel Höfgen um den Hals und sagte: „Theophil hat wieder mal das rechte Wort gefunden! Du bist wirklich eine tolle Type!“ Kroge trat hinzu, um Anerkennendes zu murmeln. Er versicherte Fräulein von Niebuhr, dass es ihm ein Vergnügen sein werde, weiter mit ihr zu arbeiten; sie möchte sich morgen vormittag ins Büro bemühen, damit man die Bedingungen bespreche. Nicoletta machte sofort ihr hinterhältig-korrektes Gesicht, verneigte sich feierlich und gab in scharfen Worten ihrer Befriedigung über diesen Entschluss des Direktors Ausdruck.
Theophil Marder hatte die beiden jungen Damen und den Schauspieler Höfgen in ein sehr teures, mehr bürgerlich-solides als mondänes Lokal eingeladen. Hendrik war hier noch niemals gewesen, was Marder Anlass gab, schneidend festzustellen, dies sei die einzige „Bude“ in Hamburg, wo Genießbares auf den Tisch komme – solide Kost, guter alter Stil, wenn man dem Dramatiker glauben durfte —; überall sonst gebe es ranziges Fett und stinkende Braten, hier aber verkehrten feine alte Herren, die noch zu leben missten; auch sei der Weinkeller gepflegt. Wirklich saßen in der braun getäfelten Stube, an deren Wänden Jagdbilder und schöne Teppiche hingen, nur bejahrte Väter, die nach Millionenvermögen aussahen. Noch würdevoller freilich als sie alle wirkte der Oberkellner: in dem Respekt, mit dem er Theophils Bestellungen entgegennahm, ließ sich ein klein wenig Ironie vermuten. Marder schlug vor, man möge mit Langusten beginnen. „Was meinen Sie, bester Heinrich?“ erkundigte er sich bei Höfgen mit jener hinterhältigen Korrektheit, die Nicoletta bei ihm gelernt haben mochte. Hendrik hatte nichts einzuwenden. Übrigens fühlte er sich etwas unsicher und befangen in dem herrschaftlichen Lokal. Ihm wollte es scheinen, als habe der Oberkellner mit Geringschätzung seinen Smoking gemustert, der fleckig war und an einigen Stellen speckig glänzte. Unter dem taxierenden Blick des feinen Kellners ward[37 - ward: поэт. impf. от werden] Hendrik sich, flüchtig, aber mit Heftigkeit, seiner umstürzlerischen Gesinnung bewusst. ,Ich gehöre nicht in dieses Lokal für kapitalistische Ausbeuter’, dachte er zornig, während er sich Weißwein eingießen ließ. Nun bereute er es, die Eröffnung des Revolutionären Theaters immer wieder hinausgeschoben zu haben. Von Marder aber war er enttäuscht. Dieser unbarmherzige, hellsichtige und gefährliche Kritiker der bourgeoisen Gesellschaft zeigte sich, da man ihm nun von Mensch zu Mensch gegenübersaß, als ein Herr mit bedenklich reaktionären Neigungen. Er hatte eine schnarrende Kommandostimme, einen tückischen Blick, trug einen viel zu tadellos gearbeiteten dunklen Anzug mit sorgfältig gewählter Krawatte, und von den Langusten, die nun serviert wurden, suchte er mit einer fatalen Kennerschaft die schönsten aus. Hatte er nicht mit jenen Figuren, die er in seinen Stücken verhöhnte, viele Eigenschaften gemein? Nun lobte er die gute alte Zeit, in der er jung gewesen und mit der die neue, oberflächliche, verkommene in keinem Punkte sich messen könne. Dabei hielt er fortwährend die kalten, unruhigen und gierigen Augen auf Nicoletta gerichtet, die ihrerseits nicht nur den Mund schlängelte, sondern auch den Körper in einem metallisch glitzernden Abendkleid. Barbara saß still dabei. Hendrik, degoutiert durch Nicolettas provokant betonten Flirt mit Marder, vielleicht auch nur eifersüchtig, wandte seine Aufmerksamkeit endlich Barbara zu. Da bemerkte er: ihr Blick war forschend auf ihn gerichtet gewesen. Hendrik Höfgen erschrak.
Mitten in seinem Herzen erschrak er darüber, dass er Barbara Bruckner begnadet fand mit einem Reiz, den er noch an keiner anderen Frau je wahrgenommen hatte. Ihm waren schon vielerlei Frauen begegnet, aber noch keine wie diese. Während er diese anschaute, erinnerte er sich, in geschwinder, aber genauer Zusammenfassung – so, als gälte es, einen Schlussstrich zu ziehen unter eine lange und beschmutzte Vergangenheit —, aller jener weiblichen Geschöpfe, mit denen er je zu tun gehabt hatte.
Sie hatte Hendrik forschend betrachtet, während er sich noch mit Marder und Nicoletta beschäftigte. Da er sie nun seinerseits anstarrte – nicht verführerisch schielend, nicht rätselhaft schillernd, sondern mit der echten Ergriffenheit, die hilflos macht —, senkte sie den Blick und wandte den Kopf halb zur Seite.
Ihr sehr einfaches schwarzes Kleid, dem der Kenner seine Herkunft von der kleinen Hausschneiderin angemerkt hätte und zu dem sie einen weißen, schulmädchenhaft steifen Kragen trug, ließ den Hals und die mageren Arme frei. Das empfindliche und genau geschnittene Oval ihres Gesichtes war blass; Hals und Arme waren bräunlich getönt, golden schimmernd, von der reifen und zarten Farbe sehr edler, in einem langen Sommer duftend gewordener Äpfel. Hendrik musste angestrengt darüber nachdenken, woran ihn diese kostbare Farbe, von der er noch betroffener war als von Barbaras Antlitz, erinnerte. Ihm fielen Frauenbilder Leonardos ein, und er war etwas gerührt darüber, dass er hier, in aller Stille, während Marder mit seiner Kenntnis alter französischer Kochrezepte prahlte, an so vornehme und hohe Gegenstände dachte; ja, auf gewissen Leonardo-Bildern gab es diese satte, sanfte, dabei spröd empfindliche Fleischfarbe; auch einige seiner Jünglinge, die den gekrümmten, lieblichen Arm aus einer schattenvollen Dunkelheit hoben, zeigten sie. Jünglinge und Madonnen auf alten Meisterbildern hatten solche Schönheit.
An Jünglinge und Madonnen ließ der Anblick Barbara Bruckners den begeisterten Hendrik denken. Nach dem Ideal geformte Knaben hatten diese schöne Magerkeit der Glieder; Madonnen aber hatten dieses Gesicht. So schlugen sie die Augen auf, genau so, wie Barbara es jetzt tat: Augen unter langen, schwarzen und starren, aber ganz natürlichen Wimpern; Augen von einem satten Dunkelblau, das ins Schwärzliche spielte. Solche Augen hatte Barbara Bruckner, und sie schauten ernst forschend, mit einer freundschaftlichen Neugier, und zuweilen beinah schalkhaft. Überhaupt war das edle Gesicht nicht ohne schalkhafte Züge: kein weinerliches, auch kein gebieterisches Madonnenantlitz, vielmehr ein durchtriebenes. Der ziemlich große und feuchte Mund lächelte versonnen, aber nicht ohne Witz. Dem träumerischen Frauenhaupt gab es eine fast kecke Note, dass der Knoten des reichen aschblonden Haares im Nacken ein wenig schief saß. Der Scheitel hingegen war genau und in der Mitte gezogen.
„Warum schauen Sie mich so an?“ fragte Barbara schließlich, da der entzückte Hendrik den Blick nicht von ihr ließ.
„Darf ich nicht?“ fragte er leise zurück.
Sie sagte mit einer burschikosen Koketterie, hinter der ihre Befangenheit sich verbarg: „Wenn es Ihnen Vergnügen macht…“
Hendrik fand: Ihre Stimme war für das Ohr der nämliche Genuss wie die Farbe ihrer Haut für das Auge. Auch ihre Stimme schien gesättigt von reifem und zartem Ton. Auch sie schimmerte, hatte den kostbar nachgedunkelten Glanz. Hendrik lauschte mit derselben Hingegebenheit, die er vorhin gehabt hatte beim Schauen. Damit sie nur weiterspräche, stellte er Fragen. Er wollte wissen, wie lange sie in Hamburg zu bleiben gedächte. Sie sagte, während sie mit einer Ungeschicklichkeit, die den Mangel an Gewohnheit verriet, an ihrer Zigarette sog: „Solange Nicoletta hier spielt. Es hängt also vom Erfolg des ,Knorke’ ab.“
„Jetzt freut es mich erst, dass das Publikum heuteabend so lange geklatscht hat“, sagte Hendrik. „Ich glaube, auch die Presse wird gut sein.“ – Er erkundigte sich nach ihren Studien – Nicoletta hatte erwähnt, dass Barbara die Universität besuchte. Sie sprach von soziologischen, historischen Kollegs. „Aber ich betreibe ja all das viel zu unregelmäßig“, sagte sie, versonnen und etwas spöttisch. Dabei stützte sie den Ellenbogen auf den Tisch und das Gesicht in die schmale, bräunliche Hand. Ein nicht so wohlwollender Beobachter, wie Hendrik es in diesem Augenblick war, hätte ihre Bewegungen, die ihm von schöner, rührender Befangenheit schienen, ungeschickt und beinah plump finden können. Die Steifheit ihrer Haltung verriet die junge Dame aus der Provinz, die nicht durchaus gewandte Professorentochter, und kontrastierte zu der klugen und heiteren Offenheit ihres Blickes. Sie hatte die Unsicherheit eines Menschen, der in einem bestimmten, eng begrenzten Milieu viel geliebt und verwöhnt worden ist, außerhalb dieses Milieus aber zu Minderwertigkeitsgefühlen neigt. Besonders in Nicolettas Gegenwart schien Barbara es gewöhnt zu sein, eine zweite Rolle zu spielen. Sie war deshalb erfreut und ein wenig belustigt darüber, dass dieser wunderliche Schauspieler, Hendrik Höfgen, auf eine so demonstrative Art sich ihr widmete, und sie setzte das Gespräch mit ihm nicht ungern fort.
„Ich mache so alles mögliche“, sagte sie nachdenklich. „Eigentlich zeichne ich… Mit Theater-dekorationen habe ich mich viel beschäftigt.“ Dies war ein Stichwort für Hendrik; er ließ die Unterhaltung lebhafter werden. Mit fliegendem Eifer, auf den Wangen eine helle Röte, sprach er von Wandlungen des dekorativen Stils, von all dem, was es auf diesem Gebiete neu zu entdecken oder wieder zu verwenden, zu verbessern gäbe. Barbara lauschte, antwortete, blickte prüfend, hatte Lächeln, rührend ungeschickte Gebärden der Arme, schalkhaft und versonnen tönende Stimme, die verständige, durchdachte Urteile sprach.
Hendrik und Barbara plauderten leise, angeregt, nicht ohne Innigkeit. Nicoletta und Marder inzwischen funkelten sich verführerisch an. Beide ließen alle ihre Künste spielen. Nicolettas schöne Raubtieraugen waren noch blanker als sonst; die Akkuratesse ihrer Aussprache bekam triumphalen Charakter. Zwischen den grell gefärbten Lippen leuchteten, wenn sie lachte und sprach, die kleinen und scharfen Zähne. Marder seinerseits ließ intellektuelles Feuerwerk sprühen. Sein beweglicher, zuckender Mund, dessen bläuliche Färbung äußerst ungesund wirkte, redete fast ununterbrochen. Übrigens hatte Marder die Neigung, mit größter Intensität immer wieder dieselben Dinge zu sagen. Vor allem bestand er mit einer passionierten Hartnäckigkeit darauf, dass die heutige Zeit, deren aufmerksamsten und berufensten Richter er sich nannte, die denkbar schlechteste, verkommenste und hoffnungsloseste aller Epochen sei. Es existierte in ihr keine geistige Bewegung, keine allgemeine Tendenz oder besondere Leistung, die sein fürchterlicher Anspruch irgend hätte gelten lassen. Vor allem fehlten in ihr, seiner Meinung nach, die Persönlichkeiten; er, Marder, war die einzige weit und breit, und er wurde verkannt. Das Verwirrende war, dass der Beobachter und Richter europäischen Verfalls dieser trostlosen Gegenwart keineswegs das Bild einer Zukunft entgegensetzte, die zu lieben und um derentwillen das Bestehende zu hassen wäre; dass er vielmehr, um das Seiende herabzusetzen, eine Vergangenheit pries, die doch gerade er durchschaut, verhöhnt und kritisch erledigt hatte. Die fiebrig animierte Nicoletta war nicht dazu geneigt, sich über irgend etwas zu wundern; sonst hätte es ihr wohl erstaunlich scheinen können, dass eben der Mann, der sich selbst den klassischen Satiriker der bürgerlichen Epoche zu nennen liebte, nun Offiziere der alten deutschen Armee und rheinische Industrielle zu Idealfiguren verklärte, die tadellose Disziplin und kühne Persönlichkeit sieghaft in sich vereinigten. Der alte Spötter, dessen selbstherrlicher, aber geistig richtungsloser Radikalismus ins Reaktionäre abgeglitten und entartet war, deklamierte schnarren-des Lob für die physischen und moralischen Qualitäten preußischer Generale und denunzierte mit der gereizten Stimme eines Unteroffiziers die schlappe Weichlichkeit des heutigen Geschlechts. „Nirgends Zucht! Nirgends Disziplin!“ schrie er so laut und zornig, dass die alten Herren, die bei ihren Rotweinflaschen saßen, erstaunt die Köpfe herdrehten. Auch die Frauen hatten jede Disziplin verloren, behauptete der aufgebrachte Marder. Sie verstanden nichts mehr von der Liebe, aus der Hingabe machten sie ein Geschäft, wie die Männer waren sie oberflächlich und vulgär geworden. Hier lachte Nicoletta so herausfordernd, dass Marder galant hinzufügte: „Ausnahmen gibt es natürlich!“
Dann aber begann er wieder zu schimpfen. Seine Ansicht ging dahin, die deutschen Männer hätten allen Sinn für Ordnung und Respekt verloren, seitdem die allgemeine Dienstpflicht abgeschafft war. Heute, in einer verlotterten Demokratie, sei alles Talmi, falsch, durch Reklame groß gemachter Betrug. „Wenn es anders wäre“, fragte Marder erbittert, „müsste ich dann nicht der erste Mann im Staate sein? Wäre die ungeheure Kraft und Kompetenz meines Hirns nicht dazu berufen, alle wesentlichen Dinge öffentlichen Lebens zu entscheiden – während heute, da jeder Instinkt und Maßstab für echten Rang abhanden kam, meine Stimme nur die beinah überhörte des öffentlichen schlechten Gewissens ist!“ Seine Augen glühten, sein hageres Gesicht, dessen Blässe zu der Schwärze des Schnurrbarts kontrastierte, war verzerrt. Um ihn zu beruhigen, erinnerte Nicoletta daran, dass die Stücke keines anderen lebenden Autors so häufig aufgeführt würden wie die seinen. Er lächelte mit flüchtig befriedigter Eitelkeit. Aber schon nach wenigen Sekunden verfinsterte er sich wieder. Plötzlich schrie er Hendrik Höfgen an, der innig vertieft in sein Gespräch mit Barbara saß: „Haben Sie vielleicht gedient, Herr?“
Hendrik, überrascht und entsetzt von so drohender Anrede, wandte ihm ein ziemlich fassungsloses Gesicht zu. Marder aber verlangte: „Antworten Sie, Herr!“ Hendrik brachte, mühsam lächelnd, hervor: „Nein, natürlich nicht… Gott sei Dank nicht…“ Darauf lachte Marder triumphierend.
„Da sieht man es wieder! Keine Disziplin! Keine Persönlichkeit! – Haben Sie vielleicht Disziplin, Herr? Sind Sie vielleicht eine Persönlichkeit? – Alles Talmi, alles Ersatz, Plebejertum, wohin ich immer schaue!“!
Das war eine Impertinenz; Hendrik wusste nicht, wie er reagieren sollte. Er fühlte Zorn in sich hochsteigen; um der Damen willen, und auch, weil Marders Ruhm ihm imponierte, entschloss er sich, einen Skandal zu vermeiden. Übrigens hielt er den Schriftsteller für nervenkrank. Welch erstaunliche und erschütternde Veränderung aber ging nun vor mit Marder, der eine schauerlich gedämpfte Stimme und prophetische Augen bekam!
„Das alles wird grässlich enden.“ Er raunte es – in welche Fernen oder in was für Abgründe schaute jetzt sein Blick, der mit einemmal eine so fürchterlich durchdringende Kraft bekam? „Es wird das Schlimmste geschehen, denkt an mich, Kinder, wenn es da ist, ich habe es vorausgesehen und vorausgewusst. Diese Zeit ist in Verwesung, sie stinkt. Denkt an mich: Ich habe es gerochen. Mich täuscht man nicht. Ich spüre die Katastrophe, die sich vorbereitet. Sie wird beispiellos sein. Sie wird alles verschlingen, und um keinen wird es schade sein, außer um mich. Alles, was steht, wird zerbersten. Es ist morsch. Ich habe es befühlt, geprüft und verworfen. Wenn es stürzt, wird es uns alle begraben. Ihr tut mir leid, Kinder, denn ihr werdet euer Leben nicht leben dürfen. Ich aber habe ein schönes Leben gehabt.“
Theophil Marder war fünfzig Jahre alt. Er war mit drei Frauen verheiratet gewesen. Er war angefeindet und ausgelacht worden; er hatte den Erfolg, den Ruhm und auch den Reichtum kennen gelernt.
Da er schwieg und nur erschüttert keuchte, sprachen auch die anderen, die mit ihm am Tisch saßen, kein Wort; Nicoletta, Barbara und Hendrik hatten die Augen niedergeschlagen.
Marder aber änderte jäh die Stimmung. Er schenkte Rotwein ein und wurde charmant. Höfgen, den er eben noch beleidigt hatte, machte er nun Komplimente über sein begabtes Spiel. „Ich weiß es wohl“, sagte er gönnerhaft, „die Rolle ist blendend, mein Dialog unvergleichlich pointiert. Aber die Jammergestalten, die sich heute Schauspieler nennen, bringen es fertig, selbst in meinen Stücken schwunglos langweilig zu sein. Sie, Höfgen, haben immerhin eine Ahnung davon, was Theater ist. Unter den Blinden fallen Sie mir als der Einäugige auf, Prost!“ Dabei hob er das Rotweinglas. „Mit unserer Barbara scheinen Sie sich ja nicht übel zu unterhalten“, sagte er launig. Barbara begegnete seinem anzüglichen Lächeln mit ernstem Blick. Hendrik zögerte, ehe er mit Theophil anstieß: die forsche Redeweise des Dramatikers im Zusammenhang mit dem wunderbaren Mädchen Barbara empfand er als unpassend. Es schien, dass Marder, der nicht nur mit seiner Kenntnis von Weinen und Saucen, sondern auch mit seinem untrügbaren Instinkt für den Wert einer Frau dröhnend renommierte, Barbara überhaupt nicht bemerkte. Augen hatte er nur für Nicoletta, die es ihrerseits sorgsam vermied, den zärtlichen und besorgten Blick zu erwidern, den Barbara zuweilen auf sie richtete.
Marder bestellte Champagner zu den Süßigkeiten, die der feine Ober eben servierte. Es war nach Mitternacht; das gediegene Lokal, in dem es keine Gäste mehr gab außer diesen vier sonderbaren, hätte längst seine Pforten geschlossen; aber Marder gab den Kellnern zu verstehen, sie würden anständige Trinkgelder bekommen, wenn sie ein wenig länger als gewöhnlich ihren Dienst taten. Der große Satiriker, das wachsame Gewissen einer verderbten Zivilisation, zeigte jetzt sein Talent zur harmlosen Gemütlichkeit. Er erzählte Witze, und zwar sowohl solche aus preußisch-militärischer als auch andere aus östlichjüdischer Sphäre. Ab und zu schaute er Nicoletta an, um zu konstatieren: „Prachtvolles Mädel! Disziplinierte Person! Heute sehr seltene Sache!“ Oder er betrachtete sich Höfgen und rief munter: „Dieser sogenannte Hendrik – eine dolle Type! Kolossal ulkiges Phänomen! Macht mir Spaß. Muss ich mir notieren!“
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/klaus-mann/mephisto-mefistofel-kniga-dlya-chteniya-na-nemeckom-yazyke/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Wilhelmstraße: eine Straße in den Berliner Ortsteilen Mitte und Kreuzberg. Sie war der Sitz wichtiger Regierungsbehörden Preußens und des Deutschen Reiches. Bis 1945 war der Begriff „Wilhelmstraße“ ein Synonym für diedeutsche Regierung.
2
Exzellenz: verwendet als Anrede oder Titel für hohe Diplomaten.
3
SS: eine Art militärisch organisierter Polizei in der Zeit des Nationalsozialismus.
4
Hohenzollern: Das Haus Hohenzollern ist eines der bedeutendsten deutschen Fürstengeschlechter, ursprünglich aus dem schwäbischen Raum. Es untergliederte sich seit dem Mittelalter in mehrere Haupt- und Nebenlinien, von denen einige wieder erloschen sind. Die (ursprünglich fränkische) Linie Brandenburg-Preußen stellte ab 1701 die preußischen Könige und von 1871 bis 1918 die Deutschen Kaiser. Das Haus Hohenzollern stellte außerdem von 1866 bis 1947 die rumänischen Könige.
5
Prolet: jemand, der sehr schlechte Manieren hat.
6
Clemenceau, Georges Benjamin, frz. Staatsmann; 1906 bis 1909 und 1917 bis 1920 Minister-Präsident; setzte die frz. Forderungen gegenüber Deutschland im Versailler Vertrag durch.
7
Briand, Aristide, frz. Staatsmann; war elfmal Ministerpräsident, 1925 bis 1932 Außenminister, beteiligt am Locarno-Pakt.
8
Abbé [frz. „Abt“]: in Frankreich Titel des Weltgeistlichen.
9
Damned snob: verdammter Snob.
10
Renkontre: Treffen, Begegnung.
11
Königin Luise (
1776, †1810), Königin von Preußen, Gemahlin Friedrich Wilhelms III.
12
Cäsar: Beiname eines Zweigs des römischen Geschlechts der Julier, auch römischer Herrscher und Thronfolger. Aus dem Namen Cäsar entstanden die Wörter Kaiser und Zar.
13
Minna von Barnhelm: die Titelrolle eines Stücks von Gotthold Ephraim Lessing (1767). „Minna von Barnhelm“ war das erste deutsche realistische Lustspiel.
14
Novemberrevolution: deutsche Revolution im November 1918. Sie begann am 30.10. mit dem Marinenaufstand in Kiel, führte am 7.11. zum Sturz der bayerischen Monarchie und am 9.11. zur Abdankung Kaiser Wilhelms II. Alle deutschen regierenden Fürsten wurden enttrohnt, in Deutschland wurde die Republik ausgerufen.
15
Wedekind, Frank (
1864, †1918), deutscher Dichter, satirischer Dramatiker, suchte die konventionelle bürgerliche Moral als Unmoral zu enthüllen.
16
Strindberg, August (
1849, †1912), schwedischer Dichter; nahm den Weg vom Naturalismus über den Individualismus zur Mystik; gestaltete den Kampf der Geschlechter und die seelische Zerrissenheit.
17
Kaiser, Friedrich Carl Georg (
1878, † 1945), der erfolgreichste Dramatiker der expressionistischen Generation. Aus seinem Wirken als Autor gingen 60 Dramen hervor, von denen aber viele in Vergessenheit geraten sind.
18
Sternheim, Carl (
1878, †1942), deutscher Dramatiker; schrieb satirische Komödien.
19
Unruh, Fritz von (
1885, †1970), deutscher Schriftsteller; Pazifist.
20
Hasenclever, Walter (
1890, †1940), deutscher Dichter; schrieb expressionistische Dramen, Lustspiele, Lyrik.
21
Toller, Ernst (
1893, †1939), deutscher Schriftsteller; 1919 Mitglied der Münchener Räteregierung; Pazifist, emigrierte 1933 in die USA.
22
Tagore, Rabindranath (
1861, †1941), indischer Dichter, Philosoph; schrieb in Bengali und Englisch Romane, Dramen und Gedichte. Nobelpreis für Literatur 1913.
23
„Raub der Sabinerinnen“: eine Komödie von Franz
24
„Pension Schöller“: ein Lustspiel von Wilhelm Jacobi und Carl Laufs. Die Uraufführung fand am 7. Oktober 1890 in Berlin statt.
25
„Die Weber“: ein soziales Drama in fünf Akten von Gerhart Hauptmann, das am 26. Februar 1893 im neuen Theater Berlin privat und am 25. September 1894 im Deutschen Theater Berlin öffentlich uraufgeführt wurde. Es behandelt den Weberaufstand von 1844.
26
Leviten, A.T.: die Tempeldiener aus dem Stamm Levi.
27
der Vertrag von Versailles: der am 28.6.1919 in Versailles von den Ententemächten und dem Deutschen Reich zur Beendigung des ersten Weltkrieges unterzeichnete Friedensvertrag.
28
„Frühlings Erwachen“: ein Drama von Frank Wedekind.
29
„Die Räuber“: ein Drama von Friedrich Schiller.
30
Reeperbahn: Vergnügungsviertel in Hamburg.
31
Kanapee: Sofa, Couch.
32
Kommst du vom Himmel, steigst du auf aus tiefen Schlünden, o Schönheit?
33
Dein Weg, o Schönheit, führt dich spottend über Leichen,
Das Graunen dient dir als Geschmeid und schenkt dir Lust,
Doch mit dem Mord kann sich kein anderer Schmuckvergleichen,
Er tanzt als Kronjuwel verliebt auf deiner Brust.
Charles Baudlaire „Les Fleurs du Mal“ (Die Blumen des Bösen); aus der „Hymne à la Beauté (Hymne an die Schönheit) in der Übersetzung von Carl Fischer.
34
Wilde, Oscar (
1854, †1900), irischer Schriftsteller, schrieb geistreiche Gesellschaftsstücke, Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“, Märchen, Gedichte.
35
Silvester: der letzte Tag des Jahres, der 31. Dezember.
36
Wilhelm II. (
1859, †1941), deutscher Kaiser und König von Preußen; erzwang 1890 den Rücktritt Otto von Bismarcks, liebte forsches Auftreten und äußeren Pomp; wurde durch seine Unbedachtheit dem selbst auferlegten Führungszwang nicht gerecht. Am 9.11.1918 wurde in Berlin seine Abdankung verkündet, er ging in die Niederlande.
37
ward: поэт. impf. от werden
Клаус Манн
Ирина Олеговна Ситникова
Originallektüre Deutsch
Клаус Манн (1906-1949) – немецкий писатель и журналист, сын Томаса Манна.
В романе «Мефистофель» (1936) сатирически трактуется тема «соучастия» людей, не противостоявших фашизму внутри Германии.
Оригинальный текст снабжен постраничными комментариями и словарем.
Klaus Mann / Клаус Манн
Mephisto / Мефистофель. Книга для чтения на немецком zpsrt
Der Schauspielerin Therese Giehse gewidmet
Alle Fehler des Menschen verzeih ich dem Schauspieler, keine Fehler des Schauspielers verzeih ich dem Menschen.
Goethe, „Wilhelm Meister“
© КАРО, 2007
Vorspiel
1936
„In einem der westdeutschen Industriezentren sollen neulich über achthundert Arbeiter verurteilt worden sein, alle zu hohen Zuchthausstrafen, und das im Laufe eines einzigen Prozesses.“
„Nach meinen Informationen sind es nur fünfhundert gewesen; über hundert andere hat man erst gar nicht abgeurteilt, sondern heimlich umbringen lassen, ihrer Gesinnung wegen.“
„Sind die Löhne wirklich so entsetzlich schlecht?“
„Miserabel. Dabei fallen sie noch – und die Preise steigen.“
„Die Dekorierung des Opernhauses für heute abend soll sechzigtausend Mark gekostet haben. Dazu kommen mindestens noch vierzigtausend Mark andere Spesen – nicht mitgerechnet die Unkosten, die es der öffentlichen Kasse gemacht hat, das Opernhaus, wegen der Vorbereitungen für den Ball, fünf Tage lang geschlossen zu halten.“
„Eine nette kleine Geburtstagsfeier.“
„Ekelhaft, dass man den Rummel mitmachen muss.“
Die beiden jungen ausländischen Diplomaten verneigten sich, auf den Gesichtern das liebenswürdigste Lächeln, vor einem Offizier in großer Uniform, der hinter seinem Monokel einen misstrauischen Blick auf sie geworfen hatte.
„Die ganze hohe Generalität ist da.“ Sie sprachen erst wieder, als sie die große Uniform außer Hörweite wussten.
„Aber sie sind alle für den Frieden begeistert“, fügte der andere boshaft hinzu.
„Wie lange noch?“ fragte fröhlich lächelnd der erste, wobei er eine kleine Dame von der japanischen Botschaft begrüßte, die am Arm eines hünenhaften Marineoffiziers klein und zierlich einherschritt.
„Wir müssen auf alles gefasst sein.“
Ein Herr vom Auswärtigen Amt gesellte sich zu den beiden jungen Botschaftsattaches, die sofort dazu übergingen, Pracht und Schönheit der Saaldekoration zu preisen. „Ja, der Herr Ministerpräsident hat Freude an diesen Dingen“, sagte, etwas verlegen, der Herr vom Auswärtigen Amt. – „Aber es ist alles geschmackvoll“, versicherten die beiden jungen Diplomaten, beinah im gleichen Atem. – „Gewiss“, sprach gequält der Herr aus der Wilhelmstraße[1 - Wilhelmstraße: eine Straße in den Berliner Ortsteilen Mitte und Kreuzberg. Sie war der Sitz wichtiger Regierungsbehörden Preußens und des Deutschen Reiches. Bis 1945 war der Begriff „Wilhelmstraße“ ein Synonym für diedeutsche Regierung.]. – „Eine so prachtvolle Veranstaltung kann man heute nirgends als in Berlin finden“, sagte einer der beiden Ausländer noch. Der Herr vom Außenministerium zögerte eine Sekunde lang, ehe er sich zu einem, höflichen Lächeln entschloss.
Es entstand eine Gesprächspause. Die drei Herren blickten um sich und lauschten dem festlichen Lärm. „Kolossal“, sagte schließlich einer von den beiden jungen Leuten leise – diesmal ohne jeden Sarkasmus, sondern wirklich beeindruckt, beinah verängstigt von dem riesenhaften Aufwand, der ihn umgab. Das Flimmern der von Lichtern und Wohlgerüchen gesättigten Luft war so stark, dass es ihm die Augen blendete. Ehrfurchtsvoll, aber misstrauisch blinzelte er in den bewegten Glanz. ,Wo bin ich nur?’ dachte der junge Herr – er kam aus einem der skandinavischen Länder —. ,Der Ort, an dem ich mich befinde, ist ohne Frage sehr lieblich und verschwenderisch ausgestattet; dabei aber auch etwas grauenhaft. Diese schön geputzten Menschen sind von einer Munterkeit, die nicht gerade vertrauenerweckend wirkt. Sie bewegen sich wie die Marionetten – sonderbar zuckend und eckig. In ihren Augen lauert etwas, ihre Augen haben keinen guten Blick, es gibt in ihnen soviel Angst und soviel Grausamkeit. Bei mir zu Hause schauen die Leute auf eine andere Art – sie schauen freundlicher und freier bei mir zu Hause. Man lacht auch anders bei uns droben im Norden. Hier haben die Gelächter etwas Höhnisches und etwas Verzweifeltes; etwas Freches, Provokantes, und dabei etwas Hoffnungsloses, schauerlich Trauriges. So lacht doch niemand, der sich wohl fühlt in seiner Haut. So lachen doch Männer und Frauen nicht, die ein anständiges, vernünftiges Leben führen…’
Der große Ball zum dreiundvierzigsten Geburtstag des Ministerpräsidenten fand in allen Räumen des Opernhauses statt. In den ausgedehnten Foyers, in den Couloirs und Vestibülen bewegte sich die geputzte Menge. Sie ließ Sektpfropfen knallen in den Logen, deren Brüstungen mit kostbaren Draperien behängt waren; sie tanzte im Parkett, aus dem man die Stuhlreihen entfernt hatte. Das Orchester, das auf der leergeräumten Bühne seinen Platz hatte, war umfangreich, als sollte es eine Symphonie aufführen, mindestens von Richard Strauss. Es spielte aber nur, in keckem Durcheinander, Militärmärsche und jene Jazzmusik, die zwar wegen niggerhafter Unsittlichkeit verpönt war im Reiche, die aber der hohe Würdenträger auf seinem Jubelfeste nicht entbehren wollte.
Hier hatte alles sich eingefunden, was in diesem Lande etwas gelten wollte, niemand fehlte – außer dem Diktator selbst, der sich wegen Halsschmerzen und angegriffener Nerven hatte entschuldigen lassen, und außer einigen etwas plebejischen Parteiprominenten, die nicht eingeladen worden waren. Hingegen bemerkte man mehrere kaiserliche und königliche Prinzen, viele Fürstlichkeiten und fast den ganzen Hochadel; die gesamte Generalität der Wehrmacht, sehr viel einflussreiche Finanziers und Schwerindustrielle; verschiedene Mitglieder des diplomatischen Korps – meistens von den Vertretungen kleinerer oder weit entfernter Länder —; einige Minister, einige berühmte Schauspieler – die huldvolle Schwäche des Jubilars für das Theater war bekannt – und sogar einen Dichter, der sehr dekorativ aussah und übrigens die persönliche Freundschaft des Diktators genoss. Über zweitausend Einladungen waren verschickt worden; von diesen waren etwa tausend Ehrenkarten, die zum unentgeltlichen Genuss des Festes berechtigten; von den Empfängern der übrigen tausend hatte jeder fünfzig Mark Eintritt zahlen müssen: So kam ein Teil der ungeheuerm Spesen wieder herein – der Rest blieb zu Lasten jener Steuerzahler, die nicht zum nähereil Umgang des Ministerpräsidenten und also keineswegs zur Elite der neuen deutschen Gesellschaft gehörten.
„Ist es nicht ein wunderschönes Fest!“ rief die umfangreiche Gattin eines rheinischen Waffenfabrikanten der Frau eines südamerikanischen Diplomaten zu. „Ach, ich amüsiere mich gar zu gut! Ich bin so glänzender Laune, und ich wünschte mir, dass alle Menschen in Deutschland, und überall, glänzender Laune würden!“
Die südamerikanische Diplomatenfrau, die nicht gut Deutsch verstand und sich langweilte, lächelte säuerlich.
Die muntere Gattin des Fabrikanten war von solchem Mangel an Enthusiasmus enttäuscht und entschloss sich dazu, weiter zu promenieren. „Entschuldigen Sie mich, meine Liebe!“ sagte sie fein und raffte die glitzernde Schleppe. „Ich muss eben mal eine alte Freundin aus Köln begrüßen – die Mutter unseres Staatstheaterintendanten, Sie wissen doch, des großen Hendrik Höfgen.“
Hier tat die Südamerikanerin zum erstenmal den Mund auf, um zu fragen: „Who is Henrik Hopfgen?“ – was die Fabrikantengattin veranlasste, leise aufzuschreien: „Wie?! Sie kennen unseren Höfgen nicht? Höfgen, meine Beste – nicht Hopfgen! Und Hendrik, nicht Henrik – er legt größten Wert auf das kleine ,d’!“ Dabei war sie schon auf die distinguierte Matrone zugeeilt, die am Arme des Dichters und Führerfreundes würdevoll durch die Säle schritt. „Liebste Frau Bella! Es ist eine Ewigkeit her, dass man sich nicht gesehen hat! Wie geht es Ihnen denn, Liebste? Haben Sie manchmal Heimweh nach unserem Köln? Aber Sie befinden sich hier ja in einer so glänzenden Position! Und wie geht es Fräulein Josy, dem lieben Kind? Vor allem: Was macht Hendrik – Ihr großer Sohn! Himmel, was ist aus ihm alles geworden! Er ist ja fast so bedeutend wie ein Minister! Jaja, liebste Frau Bella, wir in Köln haben alle Sehnsucht nach Ihnen und Ihren herrlichen Kindern!“
In Wahrheit hatte sich die Millionärin niemals um Frau Bella Höfgen gekümmert, als diese noch in Köln gelebt und ihr Sohn die große Karriere noch nicht gemacht hatte. Die Bekanntschaft zwischen den beiden Damen war nur eine flüchtige gewesen; niemals war Frau Bella eingeladen worden in die Villa des Fabrikanten. Nun aber wollte die lustige und gemütvolle Reiche die Hand der Frau, deren Sohn man zu den nahen Freunden des Ministerpräsidenten zählte, gar nicht mehr loslassen.
Frau Bella lächelte huldvoll. Sie war sehr einfach, aber nicht ohne eine gewisse ehrbare Koketterie gekleidet; auf ihrer schwarzen, glatt fließenden Seidenrobe leuchtete eine weiße Orchidee. Das graue, schlicht frisierte Haar bildete einen pikanten Kontrast zu ihrem ziemlich jung gebliebenen, mit dezenter Sorgfalt hergerichteten Gesicht. Aus weiten, grünblauen Augen schaute sie mit einer reservierten, nachdenklichen Freundlichkeit auf die geschwätzige Dame, die den lebhaften deutschen Kriegsvorbereitungen ihr wundervolles Kollier, ihre langen Ohrgehänge, die Pariser Toilette und all ihren Glanz verdankte.
„Ich kann nicht klagen, es geht uns allen recht gut“ sprach mit stolzer Bescheidenheit Frau Höfgen. „Josy hat sich mit dem jungen Grafen Donnersberg verlobt. Hendrik ist ein wenig überanstrengt, er hat rasend zu tun.“
„Das kann ich mir denken.“ Die Industrielle schaute respektvoll.
„Darf ich Ihnen unseren Freund Cäsar von Muck vorstellen“, sagte Frau Bella.
Der Dichter neigte sich über die geschmückte Hand der reichen Dame, die sofort wieder zu schwätzen begann. „Ungeheuer interessant, ich freue mich wirklich, habe Sie sofort nach den Fotografien erkannt. Ihr ,Tannenberg’-Drama habe ich in Köln bewundert, eine recht gute Aufführung, natürlich fehlen die überragenden Leistungen, wie man sie in Berlin jetzt gewöhnt ist, aber wirklich recht anständig, ohne Frage sehr achtbar. Und Sie, Herr Staatsrat – Sie haben doch inzwischen eine so großartige Reise gemacht, alle Welt spricht von Ihrem Reisebuch, ich will es mir dieser Tage besorgen.“
„Ich habe viel Schönes und viel Hässliches gesehen in der Fremde“, sagte der Dichter schlicht. „Jedoch reiste ich durch die Lande nicht nur als Schauender, nicht nur als Genießender, sondern mehr noch als Wirkender, Lehrender. Mich deucht, es ist mir gelungen, dort draußen neue Freunde für unser neues Deutschland zu werben.“ Mit seinen stahlblauen Augen, deren durchdringende und feurige Reinheit in vielen Feuilletons gepriesen wurde, taxierte er den kolossalen Schmuck der Rheinländerin. ,Ich könnte in ihrer Villa wohnen, wenn ich das nächste Mal in Köln einen Vortrag oder eine Premiere habe’, dachte er, während er weitersprach: „Es ist für unseren geraden Sinn unfassbar, wieviel Lüge, wieviel boshaftes Missverständnis über unser Reich im Umlauf sind – draußen in der Welt.“
Sein Gesicht war so beschaffen, dass jeder Reporter es „holzgeschnitten“ nennen musste: zerfurchte Stirne, Stahlauge unter blonder Braue und ein verkniffener Mund, der leicht sächsischen Dialekt sprach. Die Waffenfabrikantin war sehr beeindruckt, von seinem Aussehen wie von seiner edlen Rede. „Ach“, schaute sie ihn schwärmerisch an. „Wenn Sie einmal nach Köln kommen, müssen Sie uns unbedingt besuchen!“
Staatsrat Cäsar von Muck, Präsident der Dichterakademie und Verfasser des überall gespielten „Tannenberg“-Dramas, verneigte sich mit ritterlichem Anstand: „Es wird mir eine echte Freude sein, gnädige Frau.“ Dabei legte er sogar die Hand aufs Herz.
Die Industrielle fand ihn wundervoll. „Wie köstlich es sein wird, Ihnen einen ganzen Abend zuzuhören, Exzellenz[2 - Exzellenz: verwendet als Anrede oder Titel für hohe Diplomaten.]!“ rief sie aus. „Was Sie alles erlebt haben müssen! Sind Sie nicht auch schon Staatstheaterintendant gewesen?“
Diese Frage wurde als taktlos empfunden, und zwar sowohl von der distinguierten Frau Bella als auch vom Autor der „Tannenberg“-Tragödie. Dieser sagte denn auch nur, mit einer gewissen Schärfe: „Gewiss.“
Die reiche Kölnerin merkte nichts. Vielmehr sprach sie noch, mit durchaus deplacierter Schelmerei: „Sind Sie denn da nicht ein klein bisschen eifersüchtig, Herr Staatsrat, auf unseren Hendrik, Ihren Nachfolger?“ Nun drohte sie auch noch mit dem Finger. Frau Bella wusste nicht, wohin sie blicken sollte.
Cäsar von Muck aber bewies, dass er weltmännisch und überlegen war, und zwar in einem Grade, der an Edelmut grenzt. Über sein Holzschnittgesicht ging ein Lächeln, das nur in seinen ersten Anfängen etwas bitter schien, dann aber milde, gut und sogar weise wurde. „Ich habe diese schwere Last gerne – ja, von Herzen gerne an meinen Freund Höfgen abgegeben, der wie kein anderer berufen ist, sie zu tragen.“ Seine Stimme bebte; er war stark ergriffen von der eigenen Großmut und von der Schönheit seiner Gesinnung.
Frau Bella, die Mutter des Intendanten, zeigte eine beeindruckte Miene; die Lebensgefährtin des Kanonenkönigs aber war derartig gerührt von der edlen und majestätischen Haltung des berühmten Dramatikers, dass sie beinahe weinen musste. Mit tapferer Selbstüberwindung schluckte sie die Tränen hinunter; tupfte sich die Augen flüchtig mit dem Seidentüchlein und schüttelte die weihevolle Stimmung mit einem sichtbaren Ruck von sich ab. In ihr siegte die typisch rheinische Munterkeit; sie schaute wieder strahlend und jubilierte: „Ist es nicht ein ganz herrliches Fest?!“
Es war ein ganz herrliches Fest, darüber konnte gar kein Zweifel bestehen. Wie das glitzerte, duftete, rauschte! Gar nicht festzustellen, was mehr Glanz verbreitete: die Juwelen oder die Ordenssterne. Das verschwenderische Licht der Kronleuchter spielte und tanzte auf den entblößten, weißen Rücken und den schön bemalten Mienen der Damen; auf den Specknacken, gestärkten Hemdbrüsten oder betressten Uniformen feister Herren; auf den schwitzenden Gesichtern der Lakaien, die mit den Erfrischungen umherliefen. Es dufteten die Blumen, die in schönem Arrangement verteilt waren, durch das ganze Lusthaus; es dufteten die Pariser Parfüms all der deutschen Frauen; es dufteten die Zigarren der Industriellen und die Pomaden der schlanken Jünglinge in ihren kleidsam knappen SS[3 - SS: eine Art militärisch organisierter Polizei in der Zeit des Nationalsozialismus.]-Uniformen; es dufteten die Prinzen und die Prinzessinnen, die Chefs der Geheimen Staatspolizei, die Feuilletonchefs, die Filmdivas, die Universitätsprofessoren, die einen Lehrstuhl für Rassenoder Wehrwissenschaft innehatten, und die wenigen jüdischen Bankiers, deren Reichtum und internationale Beziehungen so gewaltig waren, dass man sie sogar an dieser exklusiven Veranstaltung teilhaben ließ. Man verbreitete Wolken künstlichen Wohlgeruchs, als gälte es, ein anderes Aroma nicht aufkommen zu lassen – den faden, süßlichen Gestank des Blutes, den man zwar liebte und von dem das ganze Land erfüllt war, dessen man sich aber bei so feinem Anlass und in Gegenwart der fremden Diplomaten ein wenig schämte.
„Tolle Sache“, sagte ein hoher Herr von der Reichswehr zum anderen. „Was der Dicke sich alles leistet!“
„Solange wir es uns gefallen lassen“, sagte der zweite. Sie machten gutgelaunte Gesichter; denn sie wurden fotografiert.
„Lotte soll ein Kleid anhaben, das dreitausend Mark kostet“, erzählte eine Filmschauspielerin dem Hohenzollernprinzen[4 - Hohenzollern: Das Haus Hohenzollern ist eines der bedeutendsten deutschen Fürstengeschlechter, ursprünglich aus dem schwäbischen Raum. Es untergliederte sich seit dem Mittelalter in mehrere Haupt- und Nebenlinien, von denen einige wieder erloschen sind. Die (ursprünglich fränkische) Linie Brandenburg-Preußen stellte ab 1701 die preußischen Könige und von 1871 bis 1918 die Deutschen Kaiser. Das Haus Hohenzollern stellte außerdem von 1866 bis 1947 die rumänischen Könige.], mit dem sie tanzte. Lotte war das Eheweib des Gewaltigen mit den vielen Titeln, der sich zu seinem dreiundvierzigsten Geburtstag feiern ließ wie ein Märchenprinz. Lotte war eine Provinzschauspielerin gewesen und galt als herzensgute, schlichte, urdeutsche Frau. An ihrem Hochzeitstage hatte der Märchenprinz zwei Proleten[5 - Prolet: jemand, der sehr schlechte Manieren hat.] hinrichten lassen.
Der Hohenzollernprinz sagte: „Einen solchen Aufwand hat meine Familie niemals getrieben. – Wann wird das hohe Paar denn übrigens Einzug halten? Unsere Erwartung soll wohl auf das äußerste gesteigert werden!“
„Lottchen versteht’s“, meinte sachlich die ehemalige Kollegin der Landesmutter. – Ein ausgesprochen herrliches Fest: Alle Anwesenden schienen es aufs intensivste zu genießen, sowohl die mit den Ehrenkarten als auch die anderen, die fünfzig Mark hatten zahlen müssen, um dabeisein zu dürfen. Man tanzte, schwatzte, flirtete; man bewunderte sich selber, die anderen und am meisten die Macht, die sich so üppige Veranstaltungen wie diese gönnen durfte. In den Logen und Wandelgängen, an den verführerischen Büfetts waren die Konversationen sehr lebhaft. Man diskutierte über die Toiletten der Damen, über das Vermögen der Herren und über die Preise, welche die Wohltätigkeitstombola bringen würde: Als das wertvollste Stück wurde ein Hakenkreuz aus Brillanten genannt, etwas sehr Niedliches und Teures, als Brosche oder als Anhänger an einem Kollier zu tragen. Eingeweihte wollten wissen, dass es auch höchst amüsante Trostpreise geben würde, zum Beispiel naturgetreu nachgebildete Tanks und Maschinengewehre aus Lübecker Marzipan. Einige Damen behaupteten launig, dass sie noch lieber ein Mordinstrument aus so süßem Stoff haben wollten als das kostbare Hakenkreuz. Es wurde viel und herzlich gelacht. Mit gedämpfteren Stimmen besprach man sich über die politischen Hintergründe der Veranstaltung. Es fiel auf, dass der Diktator abgesagt hatte und mehrere Parteiprominente nicht eingeladen worden waren; dass man aber Mitglieder der fürstlichen Familien in so großer Anzahl anwesend sah. An diesen Umstand knüpften sich mancherlei dunkle und bedeutungsvolle Gerüchte, die man sich im Flüstertöne weitergab. Auch über den Gesundheitszustand des Diktators wollte der oder jener finstere Neuigkeiten wissen; man besprach sie leise und leidenschaftlich, sowohl im Kreise der auswärtigen Pressevertreter und Diplomaten als auch bei den Herren von der Reichswehr und der Schwerindustrie.
„Es scheint also doch Krebs zu sein“, berichtete hinter vorgehaltenem Taschentuch ein Herr von der englischen Presse dem Pariser Kollegen. Bei diesem aber war er an den Falschen geraten. Pierre Larue hatte das Aussehen eines höchst gebrechlichen, dabei recht tückischen Zwerges; schwärmte aber für den Heroismus und für die schönen uniformierten Burschen des neuen Deutschland. Übrigens war er kein Journalist, sondern ein reicher Mann, der verklatschte Bücher über das gesellschaftliche, literarische und politische Leben der europäischen Hauptstädte schrieb und dessen Lebensinhalt es bedeutete, berühmte Bekanntschaften zu sammeln. Dieser ebenso groteske wie anrüchige kleine Kobold, mit dem spitzen Gesichtchen und der lamentierenden Fistelstimme einer kränklichen alten Dame, verachtete die Demokratie seines eigenen Landes und erklärte jedem, der es hören wollte, dass er Clemenceau[6 - Clemenceau, Georges Benjamin, frz. Staatsmann; 1906 bis 1909 und 1917 bis 1920 Minister-Präsident; setzte die frz. Forderungen gegenüber Deutschland im Versailler Vertrag durch.] für einen Schurken und Briand[7 - Briand, Aristide, frz. Staatsmann; war elfmal Ministerpräsident, 1925 bis 1932 Außenminister, beteiligt am Locarno-Pakt.] für einen Idioten halte, jeden höheren Gestapobeamten jedoch für einen Halbgott und die Spitzen des neudeutschen Regimes für eine Garnitur von tadellosen Göttern.
„Was verbreiten Sie für infamen Unsinn, mein Herr!“ Das Männchen schaute erschreckend boshaft; seine Stimme raschelte dürr wie gefallenes Laub. „Der Gesundheitszustand des Führers lässt nichts zu wünschen übrig. Er ist nur ein bisschen erkältet.“
Diesem kleinen Scheusal war es zuzutrauen, dass er hinging und denunzierte. Der englische Korrespondent wurde nervös; er versuchte, sich zu rechtfertigen: „Ein italienischer Kollege hat mir im Vertrauen so etwas angedeutet…“ Aber der schmächtige Liebhaber prall gefüllter Uniformen schnitt ihm mit Strenge das Wort ab:
„Genug, mein Herr! Ich will nichts mehr hören! Das ist alles unverantwortliches Geschwätz! – Entschuldigen Sie“, fügte er sanfter hinzu. „Ich muss den Exkönig von Bulgarien begrüßen. Die Prinzessin von Hessen ist bei ihm, ich habe die Bekanntschaft Ihrer Hoheit am Hofe ihres Vaters in Rom gemacht.“ Er rauschte davon, die bleichen und spitzen Händchen auf der Brust gefaltet, in der Haltung und mit dem Gesichtsausdruck eines intriganten Abbés[8 - Abbé [frz. „Abt“]: in Frankreich Titel des Weltgeistlichen.]. Der Engländer murmelte hinter ihm her: „Damned snob[9 - Damned snob: verdammter Snob.].“
Eine Bewegung ging durch den Saal, es gab ein hörbares Rauschen: Der Propagandaminister war eingetreten. Man hatte ihn heute abend nicht hier erwartet, alle wussten um seine gespannte Beziehung zu dem fetten Geburtstagskind – das sich übrigens seinerseits noch immer verborgen hielt, um aus seinem Entree dann den ganz großen Clou zu machen.
Der Propagandaminister – Herr über das geistige Leben eines Millionenvolkes – humpelte behende durch die glänzende Menge, die sich vor ihm verneigte. Eine eisige Luft schien zu wehen, wo er vorbeiging. Es war, als sei eine böse, gefährliche, einsame und grausame Gottheit herniedergestiegen in den ordinären Trubel genusssüchtiger, feiger und erbärmlicher Sterblicher. Einige Sekunden lang war die ganze Gesellschaft wie gelähmt von Entsetzen. Die Tanzenden erstarrten mitten in ihrer anmutigen Pose, und ihr scheuer Blick hing, zugleich demütig und hassvoll, an dem gefürchteten Zwerg. Der versuchte durch ein charmantes Lächeln, welches seinen mageren, scharfen Mund bis zu den Ohren hinaufzerrte, die schauerliche Wirkung, die von ihm ausging, ein wenig zu mildern; er gab sich Mühe, zu bezaubern, zu versöhnen und seine tiefliegenden, schlauen Augen freundlich blicken zu lassen. Seinen Klumpfuß graziös hinter sich her ziehend, eilte er gewandt durch den Festsaal und zeigte dieser Gesellschaft von zweitausend Sklaven, Mitläufern, Betrügern, Betrogenen und Narren sein falschbedeutendes Raubvogelprofil. An den Gruppen von Millionären, Botschaftern, Divisionskommandanten und Filmstars huschte er, tückisch lächelnd, vorüber. Es war der Intendant Hendrik Höfgen, Staatsrat und Senator, bei welchem er stehenblieb.
Noch eine Sensation! Intendant Höfgen gehörte zu den deklarierten Favoriten des Minis-terpräsidenten und Fliegergenerals, der seine Berufung an die Spitze der Staatstheater durchgesetzt hatte gegen den Willen des Propaganda-ministers. Dieser war, nach einem langen und heftigen Kampf, dazu gezwungen worden, seinen eigenen Protegé, den Dichter Cäsar von Muck, zu opfern und auf Reisen zu schicken. Nun aber ehrte er demonstrativ das Geschöpf seines Feindes durch seine Begrüßung und durch sein Gespräch. Wollte der schlaue Meister der Propaganda auf solche Weise vor der internationalen Elitegesellschaft bekunden, dass es Unstimmigkeiten und Ränke zwischen den Spitzen des deutschen Regimes gar nicht gebe und dass die Eifersucht zwischen ihm, dem Reklamechef, und dem Fliegergeneral ins hässliche Gebiet der Greuelmärchen gehöre? Oder war Hendrik Höfgen – eine der meistbesprochenen Figuren der Hauptstadt – seinerseits so unermesslich schlau, dass er es fertigbrachte, zum Propagandaminister ebenso intime Beziehungen zu unterhalten wie zum Fliegergeneral – Ministerpräsidenten? Spielte er den einen Machthaber gegen den anderen aus, ließ sich von den beiden großen Konkurrenten protegieren? Seiner legendären Geschicklichkeit wäre es zuzutrauen…
Das war ja alles ungeheuer interessant! Pierre Larue ließ den Exkönig von Bulgarien einfach stehen und trippelte durch den Saal – von seiner Neugierde dahingeweht wie eine Feder vom Winde —, um dieses sensationelle Renkontre[10 - Renkontre: Treffen, Begegnung.] aus der nächsten Nähe mit anzuschauen, Cäsar von Mucks stählerne Augen kniffen sich misstrauisch zusammen, die Millionärin aus Köln stöhnte wollüstig vor lauter Angeregtheit und Freude an der erhabenen Situation; während Frau Bella Höfgen, die Mutter des großen Mannes, allen, die in ihrer Nähe standen, gnädig und gleichsam ermunternd zulächelte, als wollte sie ihnen bedeuten: Mein Hendrik ist groß, und ich bin seine distinguierte Mutter. Trotzdem braucht ihr nun nicht gleich in die Knie zu sinken. Er und ich, wir sind auch nur von Fleisch und Blut, wenngleich sonst ausgezeichnet vor den übrigen Menschen.
„Wie geht es Ihnen, mein lieber Höfgen?“ fragte der Propagandaminister anmutig lächelnd den Intendanten. Auch der Intendant lächelte, aber nicht gleich bis zu den Ohren hinauf, sondern mit einer Vornehmheit, die fast schmerzlich wirkte. „Ich danke Ihnen, Herr Minister!“ Er sprach leise, etwas singenden Tones, dabei äußerst akzentuiert. Der Minister hatte seine Hand noch immer nicht losgelassen. „Darf ich mich nach dem Befinden Ihrer Frau Gemahlin erkundigen“, sagte der Intendant, und nun musste sein hoher Gesprächspartner endlich ein ernstes Gesicht machen. „Sie ist heute abend ein wenig unpässlich.“ Dabei ließ er die Hand des Senators und Staatsrats los. Dieser sagte wehmütig: „Wie leid mir das tut.“
Natürlich wusste er – was allen hier im Saale bekannt war —, dass die Frau des Propagandaministers völlig verzehrt und innerlich verwüstet war von Eifersucht auf die Gattin des Ministerpräsidenten. Da der Diktator selber unverehelicht blieb, war das angetraute Weib des Reklamechefs die Erste Dame im Reiche gewesen, und sie hatte diese ihre gottgewollte Funktion mit Anstand und Würde erfüllt, ihr Todfeind konnte es nicht bestreiten.
Dann aber kam diese Lotte Lindenthal daher, eine mittlere Schauspielerin – jung war sie auch nicht mehr —, und ließ sich heiraten von dem prachtliebenden Dicken. Die Frau des Propagandaministers litt unbeschreiblich. Man machte ihr den Rang der Ersten Dame streitig! Eine andere drängte sich vor! Mit einer Komödiantin ward ein Kult getrieben, als ob die Königin Luise[11 - Königin Luise (
1776, †1810), Königin von Preußen, Gemahlin Friedrich Wilhelms III.] auferstanden wäre! Immer wenn es eine Veranstaltung zu Lottes Ehren gab, ärgerte sich Frau Reklamechef so ungeheuer, dass sie Migräne bekam. Auch heute abend war sie im Bett geblieben.
„Gewiss hätte sich Ihre Frau Gemahlin hier sehr gut unterhalten.“ Höfgen machte immer noch die feierliche Miene. In seinen Worten war von Ironie keine Spur zu finden. „Zu schade, dass der Führer absagen musste. Auch der englische und der französische Botschafter sind verhindert.“
Mit diesen Feststellungen, die er in sanftestem Tone vorbrachte, verriet Höfgen seinen eigentlichen Freund und Gönner – den Ministerpräsidenten, dem er all seinen Glanz zu danken hatte – an den eifersüchtigen Propagandaminister. Diesen aber hielt er sich für alle Fälle in der Reserve.
Der gewandte Klumpfuß fragte vertraulich, nicht ohne Hohn: „Und wie ist hier die Stimmung?“
Der Intendant der Staatstheater sagte zurückhaltend: „Man scheint sich zu amüsieren.“
Die beiden Würdenträger führten ihre Unterhaltung leise; denn um sie drängten sich Neugierige, auch mehrere Fotografen waren herbeigekommen. Die Kanonenfabrikantin flüsterte eben Pierre Larue zu, der in Verzückung die bleichen Knochenhändchen über der Brust gegeneinander rieb: „Unser Intendant und der Minister – sind sie nicht ein herrliches Paar? Beide so bedeutend! Beide so schön!“ Sie drängte ihren üppigen, geschmückten Leib nahe an das gebrechliche Körperchen des Kleinen. Der zarte gallische Liebhaber des germanischen Heroismus, der strammen Jünglinge, des Führergedankens und der hohen Adelsnamen fürchtete sich vor der atmenden Nähe soviel weiblichen Fleisches. Er versuchte, sich ein wenig zurückzuziehen, während er zirpte: „Exquisit! Ganz charmant! Unvergleichlich!“ Die Rheinländerin beteuerte: „Unser Höfgen – das ist ein ganzer Mann, sage ich Ihnen! Ein Genie, so etwas gibt es weder in Paris noch in Hollywood! Und so urdeutsch, so gerade, einfach und ehrlich! Ich habe ihn ja schon gekannt, als er noch so klein gewesen ist.“ Mit der vorgestreckten Hand deutete sie an, wie klein Hendrik gewesen war, als sie, die Millionärin, seine Mutter auf den Kölner Wohltätigkeitsveranstaltungen konsequent geschnitten hatte. „Ein herrlicher Junge!“ sagte sie noch und bekam so sinnliche Augen, dass Larue panisch die Flucht ergriff.
Man hätte Hendrik Höfgen für einen Mann von etwa fünfzig Jahren gehalten; er war aber erst neununddreißig – ungeheuer jung für seinen hohen Posten. Seine fahle Miene mit der Hornbrille zeigte jene steinerne Ruhe, zu der sich sehr nervöse und sehr eitle Menschen zwingen können, wenn sie sich von vielen Leuten beobachtet wissen. Sein kahler Schädel hatte edle Form. Im aufgeschwemmten, grauweißen Gesicht fiel der überanstrengte, empfindliche und leidende Zug auf, der von den hochgezogenen blonden Brauen zu den vertieften Schläfen lief; außerdem die markante Bildung des starken Kinns, das er auf stolze Art hochgereckt trug, so dass die vornehm schöne Linie zwischen Ohr und Kinn kühn und herrisch betont ward. Auf seinen breiten und blassen Lippen lag ein erfrorenes, vieldeutiges, zugleich höhnisches und um Mitleid werbendes Lächeln. Hinter den großen, spiegelnden Brillengläsern wurden seine Augen nur zuweilen sichtbar und wirksam: Dann erkannte man, nicht ohne Schrecken, dass sie, bei aller Weichheit, eiskalt, bei aller Melancholie sehr grausam waren. Diese grüngrau schillernden Augen ließen an Edelsteine denken, die kostbar sind, aber Unglück bringen; gleichzeitig an die gierigen Augen eines bösen und gefährlichen Fisches. – Alle Damen und die meisten Herren fanden, dass Hendrik Höfgen nicht nur ein bedeutender und höchst geschickter, sondern auch ein bemerkenswert schöner Mann sei. Seine zusammengenommene, vor lauter bewusster und berechneter Anmut fast steife Haltung und sein kostbarer Frack ließen es übersehen, dass er entschieden zu fett war, vor allem in der Hüftengegend und am Hinterteil.
„Ich muss Ihnen übrigens zu Ihrem Hamlet gratulieren, mein Lieber“, sprach der Propagandaminister. „Eine famose Leistung. Die deutsche Bühne kann stolz auf sie sein.“
Höfgen neigte ein wenig das Haupt, indem er das schöne Kinn etwas nach unten drückte: Oberhalb des hohen, blendenden Kragens entstanden zahlreiche Falten am Hals. „Wer vor dem Hamlet versagt, verdient den Namen eines Schauspielers nicht.“ Seine Stimme klagte vor Bescheidenheit. Der Minister konnte eben noch konstatieren: „Sie haben die Tragödie ganz gefühlt“ – da ging ein ungeheurer Aufruhr durch den Saal.
Der Fliegergeneral und seine Gattin, die gewesene Aktrice Lotte Lindenthal, waren durch die große Mitteltüre eingetreten: Brausendes Beifallsklatschen und dröhnender Zuruf begrüßten sie. Durch ein Spalier von Menschen, aus dem Jubel stieg, schritt das erlauchte Paar. Kein Kaiser hatte jemals schöneren Einzug gehalten. Der Enthusiasmus schien ungeheuer: Jeder von den zweitausend auserlesen feinen Menschen wollte sich, den anderen und dem Ministerpräsidenten durch möglichst lautes Geschrei und Händeklatschen beweisen, einen wie glühenden Anteil er am dreiundvierzigsten Geburtstag des Hohen Herrn im besonderen und am Nationalen Staate im allgemeinen nahm. Man brüllte: „Hoch!“, „Heil!“ und: „Wir gratulieren!“ Man warf Blumen, die von Frau Lotte mit würdevoller Grazie empfangen wurden. Die Kapelle spielte großen Tusch. Der Propagandaminister bekam ein hassverzerrtes Gesicht; aber darauf achtete niemand, außer vielleicht Hendrik Höfgen. Dieser stand unbeweglich: Er erwartete seinen Gönner in zusammengenommener, anmutig steifer Haltung.
Man hatte Wetten darüber abgeschlossen, in welcher Phantasieuniform der Dicke heute abend erscheinen würde. Es war eine asketische Koketterie von ihm, nun die Gesellschaft durch den allerschlichtesten Aufzug zu verblüffen. Die flaschengrüne Litewka, die er trug, wirkte fast wie eine streng geschnittene Hausjacke. Auf der Brust blitzte ihm nur ein ganz kleiner silberner Ordensstern. In den grauen Hosen wirkten seine Beine – die er sonst gerne unter langen Mänteln verbarg – besonders umfangreich: es waren Säulen, auf denen er sich langsam dahinbewegte. Die kolossalische Größe und Breite seiner monströsen Figur waren geeignet, Schrecken und Ehrfurcht um sich zu verbreiten – zumal kein Anlass bestand, irgend etwas an ihm komisch zu finden: Dem Kühnsten verging das Lachen, wenn er erwog, wieviel Blut schon auf den Wink des Speck-und-Fleisch-Riesen geflossen war und wie unermesslich viel Blut vielleicht noch strömen würde zu seinen Ehren. Auf dem kurzen, wulstigen Hals erschien sein massives Haupt wie übergossen von dem roten Safte: das Haupt eines Cäsars[12 - Cäsar: Beiname eines Zweigs des römischen Geschlechts der Julier, auch römischer Herrscher und Thronfolger. Aus dem Namen Cäsar entstanden die Wörter Kaiser und Zar.], von dem man die Haut abgezogen hat. An diesem Gesicht war nichts Menschliches mehr: Es war aus rohem, umgeformtem Fleische ein Klotz.
Der Ministerpräsident schob seinen Bauch, dessen enorme Wölbung in die der Brust überging, majestätisch durch die strahlende Versammlung. Der Ministerpräsident grinste.
Sein Weib Lotte grinste nicht, sondern verschenkte Lächeln, eine Königin Luise in jedem Zoll. Auch ihre Robe, deren Kostbarkeit den Gesprächsstoff der Damen gebildet hatte, war einfach bei allem Pomp: glatt fließend, aus einem schimmernden Silbergewebe, endend in einer königlich langen Schleppe. Das Brillantendiadem aber in der ährenblonden Frisur, die Perlen und Smaragde auf dem Busen übertrafen an Gewicht und Strahlenglanz alles, was es sonst noch zu bewundern gab in dieser üppigen Runde. Das riesenhafte Geschmeide der Provinzschauspielerin repräsentierte Millionenwerte: Sie verdankte es der Galanterie eines Gatten, der gerne die Prunksucht und Korrumpiertheit republikanischer Minister und Bürgermeister in öffentlicher Rede geißelte, und der Treue einiger wohlsituierter und bevorzugter Untertanen. Sie galt als uneigennützig, unantastbar rein. Sie war zur Idealgestalt geworden unter den deutschen Frauen. Sie hatte große, runde, etwas hervortretende Kuhaugen von einem feuchtstrahlenden Blau; schönes blondes Haar und einen schneeweißen Busen. Übrigens war auch sie schon ein wenig zu dick – man speiste gut und reichlich im Präsidentenpalais. Man erzählte sich bewundernd von ihr, dass sie sich gelegentlich bei ihrem Gatten für Juden aus der guten Gesellschaft einsetze – die Juden kamen trotzdem ins Konzentrationslager. Man nannte sie den guten Engel des Ministerpräsidenten; indessen war der Fürchterliche nicht milder geworden, seitdem sie ihn beriet. Eine ihrer berühmtesten Rollen war die Lady Milford in Schillers „Kabale und Liebe“ gewesen: jene Matresse eines Gewaltigen, die den Glanz ihres Geschmeides und die Nähe ihres Fürsten nicht mehr erträgt, da sie erfahren hat, womit man Edelsteine bezahlt. Als sie zum letztenmal im Staatstheater auftrat, spielte sie die Minna von Barnhelm[13 - Minna von Barnhelm: die Titelrolle eines Stücks von Gotthold Ephraim Lessing (1767). „Minna von Barnhelm“ war das erste deutsche realistische Lustspiel.]: So deklamierte sie, ehe sie in den Palast des Fliegergenerals übersiedelte, noch einmal die Sätze eines Dichters, den ihr Gemahl und seine Spießgesellen hetzen und verfolgen lassen würden, lebte er heute und hier. In ihrer Gegenwart wurden die schauerlichen Geheimnisse des totalen Staates besprochen: Sie lächelte mütterlich. Morgens, wenn sie ihrem Gatten neckisch über die Schulter lugte, sah sie Todesurteile vor ihm auf dem Renaissance-schreibtisch – und er unterzeichnete sie; abends zeigte Sie den weißen Busen und die ährenblonde Kunstfrisur in Opernpremieren oder an den geschmückten Tafeln der Bevorzugten, die ihres Umgangs gewürdigt wurden. Sie war unberührbar, unangreifbar; denn sie war ahnungslos und sentimental. Sie glaubte sich umgeben von der „Liebe ihres Volkes“, weil zweitausend Ehrgeizige, Käufliche und Snobs Lärm machten zu ihren Ehren. Wie sie dahinschritt, erhobenen Hauptes, übergossen vom Licht und von der allgemeinen Bewunderung, gab es keinen Zweifel in ihrem Herzen an der Haltbarkeit solchen Zaubers. Niemals – so meinte sie zuversichtlich —, niemals würde abfallen von ihr dieser Glanz; niemals würden die Gemarterten sich rächen, niemals würde die Finsternis nach ihr greifen.
Immer noch wurde Tusch gespielt, ebenso laut wie ausführlich; immer noch dauerte das huldigende Geschrei. Inzwischen waren Lotte und ihr Dicker beim Propagandaminister und bei Höfgen angekommen. Die drei Herren hoben flüchtig die Arme, die Grußzeremonie lässig andeutend. Dann neigte Hendrik sich mit einem ernsten und innigen Lächeln über die Hand der großen Dame, die er so oft auf der Bühne hatte umarmen dürfen. – Hier standen sie, dargeboten der brennenden Neugier einer gewählten Öffentlichkeit: vier Mächtige in diesem Lande, vier Gewalthaber, vier Komödianten – der Reklamechef, der Spezialist für Todesurteile und Bombenflugzeuge, die geheiratete Sentimentale und der fahle Intrigant. Die gewählte Öffentlichkeit beobachtete, wie der Dicke dem Herrn Intendanten auf die Schulter schlug, dass es krachte, und sich mit einem grunzenden Lachen erkundigte: „Na, wie geht’s, Mephisto?“
Die Sentimentale sagte mit seelenvollem Blick zum Intendanten, für den sie eine geheime – jedoch nicht gar zu geheime – Zuneigung im Busen trug: „Ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, Hendrik, wie wunderschön ich Ihren Hamlet finde.“ Er drückte ihr schweigend die Hand, wobei er einen Schritt näher an sie herantrat und ebenso innig zu blicken versuchte, wie es ihr von der Natur gegeben war. Der Versuch musste missglücken: Seine fischigen Juwelenaugen gaben soviel sanfte Wärme nicht her. Deshalb machte er ein ernstes, beinah etwas ärgerliches, offizielles Gesicht und murmelte: „Ich muss ein paar Worte sprechen.“ Dann erhob er die Stimme. Sie hatte einen leuchtenden, raffiniert geschulten Metallton und war bis in die entferntesten Winkel des großen Saales hörbar und wirksam, als sie ausrief: „Herr Ministerpräsident! Hoheiten, Exzellenzen, meine Damen und Herren! Wir sind stolz – ja, wir sind stolz und froh, dass wir dieses Fest heute in diesem Hause mit Ihnen, Herr Ministerpräsident, und mit Ihrer wundervollen Gattin begehen dürfen…“
Mit dem ersten seiner Worte war das bewegte Gespräch der Zweitausend-Personen-Gesellschaft verstummt. In vollkommener Stille, in devoter Regungslosigkeit lauschte man der langen, pathetischen und platten Glückwunschrede, die der Intendant, Senator und Staatsrat für seinen Ministerpräsidenten hielt. Alle Augen waren auf Hendrik Höfgen gerichtet. Alle bewunderten ihn. Er gehörte zur Macht. Seine Stimme brachte, anlässlich des dreiundvierzigsten Geburtstages seines Herrn, die überraschendsten Jubeltöne hervor. Er hielt das Kinn hochgereckt, die Augen schimmerten, seine sparsamen und kühnen Gesten hatten den schönsten Schwung. Er vermied es aufs sorgsamste, ein wahres Wort zu sagen. Der skalpierte Cäsar, der Reklamechef und die Kuhäugige schienen darüber zu wachen, dass nur Lügen, nichts als Lügen von seinen Lippen kämen: Eine geheime Verabredung verlangte es so, in diesem Saale wie im ganzen Land.
Während er sich dem Ende seiner Ansprache mit bravourös gesteigertem Tempo näherte, flüsterte eine hübsche, kindlich aussehende kleine Dame – die Gattin eines bekannten Filmregisseurs —, die im Hintergrund des Raumes ein bescheidenes Plätzchen hatte, tonlos ihrer Nachbarin zu: „Wenn er fertig ist, muss ich hingehen und ihm die Hand schütteln. Ist es nicht fantastisch? Ich kenne ihn doch noch von früher – ja, wir sind in Hamburg zusammen engagiert gewesen. Das waren ulkige Zeiten! Und was hat der Mensch seitdem für eine Karriere gemacht!!“
I
H. K
In den letzten Jahren des Weltkrieges und in den ersten Jahren nach der Novemberrevolution[14 - Novemberrevolution: deutsche Revolution im November 1918. Sie begann am 30.10. mit dem Marinenaufstand in Kiel, führte am 7.11. zum Sturz der bayerischen Monarchie und am 9.11. zur Abdankung Kaiser Wilhelms II. Alle deutschen regierenden Fürsten wurden enttrohnt, in Deutschland wurde die Republik ausgerufen.] hatte das literarische Theater in Deutschland eine große Konjunktur. Um diese Zeit erging es auch dem Direktor Oskar H. Kroge glänzend, den schwierigen Wirtschaftsverhältnissen zum Trotz. Er leitete eine Kammerspielbühne in Frankfurt am Main. In dem engen, stimmungsvoll intimen Kellerraum traf sich die intellektuelle Gesellschaft der Stadt und vor allem eine angeregte, von den Ereignissen aufgewühlte, diskussions- und beifallsfreudige Jugend, wenn es die Neuinszenierung eines Stückes von Wedekind[15 - Wedekind, Frank (
1864, †1918), deutscher Dichter, satirischer Dramatiker, suchte die konventionelle bürgerliche Moral als Unmoral zu enthüllen.] oder Strindberg[16 - Strindberg, August (
1849, †1912), schwedischer Dichter; nahm den Weg vom Naturalismus über den Individualismus zur Mystik; gestaltete den Kampf der Geschlechter und die seelische Zerrissenheit.] gab oder eine Uraufführung von Georg Kaiser[17 - Kaiser, Friedrich Carl Georg (
1878, † 1945), der erfolgreichste Dramatiker der expressionistischen Generation. Aus seinem Wirken als Autor gingen 60 Dramen hervor, von denen aber viele in Vergessenheit geraten sind.], Sternheim[18 - Sternheim, Carl (
1878, †1942), deutscher Dramatiker; schrieb satirische Komödien.], Fritz von Unruh[19 - Unruh, Fritz von (
1885, †1970), deutscher Schriftsteller; Pazifist.], Hasenclever[20 - Hasenclever, Walter (
1890, †1940), deutscher Dichter; schrieb expressionistische Dramen, Lustspiele, Lyrik.] oder Toller[21 - Toller, Ernst (
1893, †1939), deutscher Schriftsteller; 1919 Mitglied der Münchener Räteregierung; Pazifist, emigrierte 1933 in die USA.]. Oskar H. Kroge, der selbst Essays und hymnische ‘Gedichte’ schrieb, empfand das Theater als die moralische Anstalt: von der Schaubühne sollte eine neue Generation erzogen werden zu den Idealen, von denen man damals glaubte, dass die Stunde ihrer Erfüllung gekommen sei – zu den Idealen der Freiheit, der Gerechtigkeit, des Friedens. Oskar H. Kroge war pathetisch, zuversichtlich und naiv. Am Sonntagvormittag, vor der Aufführung eines Stückes von Tolstoi oder von Rabindranath Tagore[22 - Tagore, Rabindranath (
1861, †1941), indischer Dichter, Philosoph; schrieb in Bengali und Englisch Romane, Dramen und Gedichte. Nobelpreis für Literatur 1913.], hielt er eine Ansprache an seine Gemeinde. Das Wort „Menschheit“ kam häufig vor; den jungen Leuten, die sich im Stehparkett drängten, rief er mit bewegter Stimme zu: „Habet den Mut zu euch selbst, meine Brüder!“ – und er erntete Beifallsstürme, da er mit den Schillerworten schloss: „Seid umschlungen, Millionen!“
Oskar H. Kroge war sehr beliebt und angesehen in Frankfurt am Main und überall dort im Lande, wo man an den kühnen Experimenten eines geistigen Theaters Anteil nahm. Sein ausdrucksvolles Gesicht mit der hohen, zerfurchten Stirn, der schütteren, grauen Haarmähne und den gutmütigen, gescheiten Augen hinter der Brille mit schmalen Goldrand war häufig zu sehen in den kleinen Revuen der Avantgarde; zuweilen sogar in den großen Illustrierten. Oskar H. Kroge gehörte zu den aktivsten und erfolgreichsten Vorkämpfern des dramatischen Expressionismus.
Es war ohne Frage ein Fehler von ihm gewesen – nur zu bald sollte es ihm klarwerden – sein stimmungsvolles kleines Haus in Frankfurt aufzugeben. Das Hamburger Künstlertheater, dessen Direktion man ihm im Jahre 1923 anbot, war freilich größer. Deshalb akzeptierte er. Das Hamburger Publikum aber erwies sich als längst nicht so zugänglich dem leidenschaftlichen und anspruchsvollen Experiment wie jener zugleich routinierte und enthusiastische Kreis, der den Frankfurter Kammerspielen treu gewesen war. Im Hamburger Künstlertheater musste Kroge, außer den Dingen, die ihm am Herzen lagen, immer noch den „Raub der Sabinerinnen“[23 - „Raub der Sabinerinnen“: eine Komödie von Franz] und „Pension Schöller“[24 - „Pension Schöller“: ein Lustspiel von Wilhelm Jacobi und Carl Laufs. Die Uraufführung fand am 7. Oktober 1890 in Berlin statt.] zeigen. Darunter litt er. Jeden Freitag, wenn der Spielplan für die kommende Woche festgesetzt wurde, gab es einen kleinen Kampf mit Herrn Schmilz, dem geschäftlichen Leiter des Hauses. Schmilz wollte die Possen und Reißer angesetzt haben, weil sie Zugstücke waren; Kroge aber bestand auf dem literarischen Repertoire. Meistens musste Schmilz, der übrigens eine herzliche Freundschaft und Bewunderung für Kroge hatte, nachgeben. Das Künstlertheater blieb literarisch – was seinen Einnahmen schädlich war.
Kroge klagte über die Indifferenz der Hamburger Jugend im besonderen und über die Ungeistigkeit einer Öffentlichkeit im allgemeinen, und Paul von Schönthan, in der es um ein Theaterstück geht, das Gymnasialprofessor Gollwitz als Student geschrieben hat – eine Jugendsünde, wie er es nennt. die sich allem Höheren entfremdet habe. „Wie schnell es gegangen ist!“ stellte er mit Bitterkeit fest. „Im Jahre 1919 lief man noch zu Strindberg und Wedekind; 1926 will man nur mehr Operetten.“ Oskar H. Kroge war anspruchsvoll und übrigens ohne prophetischen Geist. Hätte er sich beschwert über das Jahr 1926, wenn er sich hätte vorstellen können, wie das Jahr 1936 aussehen würde? – „Nichts Besseres zieht mehr“, grollte er noch. „Sogar bei den Webern[25 - „Die Weber“: ein soziales Drama in fünf Akten von Gerhart Hauptmann, das am 26. Februar 1893 im neuen Theater Berlin privat und am 25. September 1894 im Deutschen Theater Berlin öffentlich uraufgeführt wurde. Es behandelt den Weberaufstand von 1844.] gestern ist das Haus halb leer gewesen.“
„Immerhin kommen wir doch zur Not noch auf unsere Rechnung.“ Direktor Schmilz bemühte sich, den Freund zu trösten: „Aber wie!“ Kroge wollte sich durchaus nicht trösten lassen. „Aber wie kommen wir denn auf unsere Rechnung! Berühmte Gäste aus Berlin müssen wir uns einladen – so wie heute abend —, damit die Hamburger ins Theater gehen.“
Hedda von Herzfeld – Kroges alle Mitarbeiterin und Freundin, die schon in Frankfurt Dramaturgin und Schauspielerin bei ihm gewesen war – bemerkte: „Du siehst wieder mal alles schwarz in schwarz, Oskar H.! Es ist ja schließlich keine Schande, Dora Martin gastieren zu lassen – sie ist wundervoll —, und übrigens kommen unsere Hamburger auch, wenn Höfgen spielt.“ Während sie Höfgens Namen aussprach, lächelte Frau von Herzfeld klug und zärtlich. Über ihr großes, matt gepudertes Gesicht mit der fleischigen Nase, den großen, goldbraunen, wehmütig intelligenten Augen ging ein bescheidenes Aufleuchten.
Kroge sagte brummig: „Höfgen wird überzahlt.“
„Die Martin übrigens auch“, fügte Schmilz hinzu. „Ihren ganzen Zauber in Ehren und zugegeben, dass sie ungeheuer zieht: aber tausend Mark Abendgage, das ist doch wohl ein bisschen toll.“
„Berliner Staransprüche“, machte Hedda spöttisch. Sie hatte in Berlin nie zu tun gehabt und behauptele, den Betrieb der Hauptstadt zu verachten.
„Tausend Mark im Monat für Höfgen ist auch übertrieben“, behauptete Kroge, plötzlich gereizt. „Seit wann hat er denn eigentlich tausend?“ fragte er herausfordernd Schmilz. „Es sind doch immer nur achthundert gewesen, und das war reichlich genug.“
„Was soll ich machen?“ Schmilz entschuldigte sich. „Er ist zu mir ins Büro gesprungen, und er hat sich mir auf den Schoß gesetzt.“ Frau von Herzfeld konnte mit Belustigung feststellen, dass Schmilz etwas rot wurde, während er dies erzählte. „Er hat mich am Kinn gekitzelt und hat immer wieder gesagt: ,Tausend Mark müssen es sein! Tausend, Direktorchen! Es ist eine so schöne runde Summe!’ Was sollte ich da machen, Kroge? Sagen Sie selbst!“
Es war Höfgens schlaue Gewohnheit, wie ein nervöser kleiner Sturmwind in Schmitzens Büro zu fahren, wenn er Vorschuss oder Gagenerhöhung wollte. Zu solchen Anlässen spielte er den übermütig Launischen und Kapriziösen, und er wusste, dass der ungeschickte dicke Schmilz verloren war, wenn er ihm die Haare zauste und den Zeigefinger munter in den Bauch stieß. Da es sich um die Tausend-Mark-Gage handelte, hatte er sich ihm sogar auf den Schoß gesetzt: Schmilz gestand es unter Erröten.
„Das sind Albernheiten!“ Kroge schüttelte ärgerlich das versorgte Haupt. „Überhaupt ist Höfgen ein grundalberner Mensch. Alles an ihm ist falsch, von seinem literarischen Geschmack bis zu seinem sogenannten Kommunismus. Er ist kein Künstler, sondern ein Komödiant.“
„Was hast du gegen unseren Hendrik?“ Frau von Herzfeld zwang sich zu einem ironischen Ton; in Wahrheit war ihr keineswegs nach Ironie zumute, wenn sie von Höfgen sprach, für dessen geübte Reize sie nur zu empfänglich war, „Er ist unser bestes Stück. Wir können froh sein, wenn wir ihn nicht an Berlin verlieren.“
„Ich bin gar nicht so besonders stolz auf ihn“, sagte Kroge. „Er ist doch nicht mehr als ein routinierter Provinzschauspieler, und das weiß er übrigens im Grunde selbst ganz genau.“
Schmilz fragte: „Wo steckt er denn heute abend?“ – worauf Frau von Herzfeld leise durch die Nase lachte: „Er hat sich in seiner Garderobe hinter einem Paravent versteckt – der kleine Bock hat es mir erzählt. Er ist immer furchtbar aufgeregt und eifersüchtig, wenn Berliner Gäste da sind. So weit wie die werde er es niemals bringen, sagt er dann – und versteckt sich hinter einem Paravent, vor lauter Hysterie. Die Martin bringt ihn wohl besonders aus der Fassung, das ist so eine Art von Hassliebe bei ihm. Heute abend soll er schon einen Weinkrampf gehabt haben.“
„Da seht ihr seinen Minderwertigkeitskomplex!“ rief Kroge und schaute triumphierend um sich. „Oder vielmehr: dass er im Grunde irgendwo die richtige Einschätzung hat für sich selber.“
Die drei saßen in der Theaterkantine, die, nach den Initialen des Hamburger Künstlertheaters, kurz „H. K.“ genannt wurde.
Drunten, im Theater, spielte Dora Martin, die mit ihrer heiseren Stimme, der verführerischen Magerkeit des ephebischen Körpers und den tragisch weiten, kindlichen und unergründlichen Augen das Publikum der großen deutschen Städte verhexte, einen Reißer zu Ende. Die beiden Direktoren und Frau von Herzfeld hatten nach dem zweiten Akt ihre Loge verlassen. Die übrigen Mitglieder des Künstlertheaters waren im Saal geblieben, um der Berliner Kollegin, die sie halb bewunderten und halb hassten, bis zum Schluss zuzusehen.
„Das Ensemble, das sie sich mitgebracht hat, ist ja wirklich unter jeder Kritik“, stellte Kroge verächtlich fest.
„Was wollen Sie?“ meinte Schmilz. „Wie soll sie jeden Abend ihre tausend Mark verdienen, wenn sie sich auch noch teure Leute mit auf die Reise nimmt?“
„Aber sie selber wird immer besser“, sagte die kluge Herzfeld. „Sie kann sich jede Manieriertheit leisten. Sie kann wie ein geisteskrankes Baby sprechen: Sie bezwingt.“
„Geisteskrankes Baby ist nicht schlecht“, lachte Kroge. „Man scheint unten fertig zu sein“, fügte er hinzu, mit einem Blick durchs Fenster. Die Leute kamen den gepflasterten Weg herauf, der vom Theater, an der Kantine vorbei, zu dem Tor führte, durch das man auf die Straße trat.
Nach und nach füllte sich die Kantine. Die Schauspieler grüßten mit einer respektvoll betonten Herzlichkeit den Direktorentisch und riefen dem Wirt, einem gedrungenen, kräftigen Greise mit weißem Knebelbart und blauroter Nase, kleine Scherze zu. Väterchen Hansemann, der Kantinenbesitzer, war für das Ensemble eine beinah ebenso bedeutungsvolle Persönlichkeit wie Schmilz, der geschäftliche Direktor. Von Schmilz konnte man Vorschuss bekommen, wenn er sich gerade in gnädiger Laune befand; bei Hansemann aber musste man anschreiben lassen, wenn in der zweiten Monatshälfte die Gage aufgebraucht und ein Vorschuss nicht genehmigt worden war. Alle standen bei ihm in der Kreide; man behauptete, dass Höfgen ihm mehr als hundert Mark schuldig war.
Alle sprachen über Dora Martin, jeder hatte seine eigene Ansicht über den Rang ihrer Leistung; nur darüber, dass sie entschieden zuviel Geld verdiente, waren alle sich einig.
Die Motz erklärte: „An dieser Starwirtschaft geht das deutsche Theater zugrunde“ – wozu ihr Freund Petersen grimmig nickte. Petersen war Väterspieler mit dem Ehrgeiz zum Heroischen; er bevorzugte Könige oder adlige alte Haudegen in historischen Stücken. Leider war er etwas zu klein und dick für diese Partien – was er auszugleichen suchte durch eine stramme und kampfeslustige Haltung. Zu seinem Gesicht, das den Ausdruck falscher Biederkeit zeigte, hätte ein grauer Schifferbart gepasst; da er fehlte, wirkte seine Miene ein wenig kahl, mit der langen, rasierten Oberlippe und den sehr blauen, ausdrucksvoll blitzenden, zu kleinen Augen. Die Motz liebte ihn mehr als er sie: das wussten alle. Da er genickt hatte, wandte sie sich nun direkt an ihn, um in einem intimen und bedeutungsvollen Ton zu sagen: „Nicht wahr, Petersen: über diese Misswirtschaft haben wir schon häufig miteinander gesprochen?“ Er bestätigte treuherzig: „Gewiss doch, Frau!“ und blinzelte Rahel Mohrenwitz zu, die aufgemacht war als das perverse und dämonische junge Mädchen: mit schwarzen Ponys bis zu den rasierten Augenbrauen und einem großen, schwarzgerandeten Monokel im Gesicht, das übrigens kindlich, pausbäckig und völlig ungeformt war.
„In Berlin wirken die Martinschen Mätzchen vielleicht“, sprach die Motz resolut. „Aber unsereinem kann sie nichts vormachen, wir sind schließlich lauter alte Theaterhasen.“ Sie blickte beifallheischend um sich. Ihr Fach war die komische Alte; zuweilen durfte sie auch reife Salon-damen spielen. Sie lachte gern, viel und laut, wobei sie scharfe Falten um den Mund bekam, in dessen Innerem Gold funkelte. Im Augenblick freilich zeigte sie eine würdevoll ernste, beinah zornige Miene.
Rahel Mohrenwitz sagte, wobei sie hochmütig mit ihrer langen Zigarettenspitze spielte: „Niemand kann schließlich leugnen, dass die Martin irgendwo eine enorm starke Persönlichkeit ist. Was sie auf der Bühne auch macht: immer ist sie unerhört intensiv da – ihr versteht, was ich meine…“ Alle verstanden es; die Motz aber schüttelte missbilligend den Kopf, während die kleine Angelika Siebert mit ihrem hohen, schüchternen Stimmchen erklärte: „Ich bewundere die Martin. Es geht eine zauberhafte Kraft von ihr aus, finde ich…“ Sie wurde sehr rot, weil sie einen so langen und gewagten Satz vorgebracht hatte. Alle sahen mit einer gewissen Rührung zu ihr hin. Die kleine Siebert war reizend. Ihr Köpfchen mit dem kurzgeschnittenen, links gescheitelten blonden Haar glich dem eines dreizehnjährigen Buben. Ihre hellen und unschuldigen Augen wurden dadurch nicht weniger anziehend, dass sie kurzsichtig waren: manche fanden, dass gerade die Art, auf die Angelika beim Schauen die Augen zusammenkniff, ihren besonderen Charme ausmache.
„Unsere Kleine schwärmt wieder einmal“, sagte der schöne Rolf Bonetti und lachte etwas zu laut. Er war jenes Mitglied des Ensembles, das die meisten Liebesbriefe aus dem Publikum erhielt: daher sein stolzer, müder, vor lauter Blasiertheit beinah angewiderter Gesichtsausdruck. Der kleinen Angelika gegenüber jedoch war er der Werbende: schon seit längerem bemühte er sich um sie. Auf der Bühne durfte er sie oft in den Armen halten, das brachte sein Rollenfach mit sich. Im übrigen aber blieb sie spröde. Mit einer wunderlichen Hartnäckigkeit verschenkte sie ihre Zärtlichkeit nur dorthin, wo nicht die mindeste Aussicht bestand, dass man sie erwiderte oder auch nur wünschte. Rührend und begehrenswert, wie sie war, schien sie ganz dafür gemacht, viel geliebt und sehr verwöhnt zu werden. Der sonderbare Eigensinn ihres Herzens aber ließ sie kühl und spöttisch bleiben vor Rolf Bonettis stürmischen Beteuerungen, und ließ sie bitterlich weinen über die eisige Geringschätzung, die Hendrik Höfgen ihr gegenüber an den Tag legte.
Rolf Bonetti sagte kennerhaft: „Als Frau kommt diese Martin jedenfalls gar nicht in Frage: ein unheimlicher Zwitter – sicher hat sie so etwas wie Fischblut in den Adern.“
„Ich finde sie schön“, sagte Angelika, leise aber entschlossen. „Sie ist die schönste Frau, finde ich.“ Schon standen ihr die Augen voll Tränen: Angelika weinte häufig, auch ohne besonderen Anlass. Träumerisch sagte sie noch: „Es ist merkwürdig – ich spüre irgendeine geheimnisvolle Ähnlichkeit zwischen Dora Martin und Hendrik…“ Dies erregte allgemeine Verwunderung.
„Die Martin ist eine Jüdin.“ Es war der junge Hans Miklas, der sich unvermittelt so vernehmen ließ. Alle schauten betroffen und etwas angewidert zu ihm hin. – „Der Miklas ist köstlich“, sprach die Motz in ein betretenes Schweigen hinein und versuchte zu lachen. Kruge runzelte die Stirne, verwundert und degoutiert, während Frau von Herzfeld nur den Kopf schütteln konnte; übrigens war sie blass geworden. Da die Pause lang und peinlich wurde – der junge Miklas stand bleich und trotzig an die Theke gelehnt —, sagte Direktor Kruge schließlich ziemlich scharf: „Was soll denn das?“ und machte ein Gesicht, so böse, wie es ihm eben möglich war. Ein anderer junger Schauspieler, der sich bis dahin leise mit Vater Hansemann unterhalten hatte, sagte forsch und versöhnlich: „Hoppla, das ist danebengegangen! Lass nur, Miklas, so was kann vorkommen, du bist sonst ein ganz braves Kind!“ Dabei klopfte er dem Übeltäter auf die Schulter und lachte so herzlich, dass alle einstimmen konnten; sogar Kroge entschloss sich zu einer Heiterkeit, die freilich krampfhaften Charakter hatte: er schlug sich, mit der flachen Hand auf den Schenkel und warf den Oberkörper nach vorne, so heftig schien er sich plötzlich zu amüsieren. Miklas aber blieb ernst; er drehte das verstockte, bleiche Gesicht zur Seite, die Lippen böse aufeinandergepresst. „Sie ist doch eine Jüdin.“ Er sprach so leise, dass fast niemand es hören konnte; nur Otto Ulrichs, der gerade erst durch seine Unbefangenheit die Situation gerettet hatte, hörte es, und nun strafte er ihn mit einem ernsten Blick.
Nachdem Direktor Kroge durch sein Gelächter ausführlich bekundet hatte, dass er die Entgleisung des jungen Miklas durchaus von der komischen Seite nahm, winkte er Ulrichs. „Ach, Ulrichs, kommen Sie doch bitte mal einen Augenblick!“ Ulrichs setzte sich an den Tisch zu den Direktoren und Frau von Herzfeld.
„Ich will mich nicht in Ihre Angelegenheiten mischen, wirklich nicht.“ Kroge ließ es sich anmerken, dass die Sache ihm äußerst peinlich war. „Aber es kommt jetzt immer häufiger vor, dass Sie in kommunistischen Versammlungen auftreten. Gestern haben Sie schon wieder irgendwo mitgemacht. Das schadet Ihnen doch, Ulrichs, und uns schadet es auch.“ Kroge sprach leise. „Sie wissen doch, wie die bürgerlichen Zeitungen sind, Ulrichs“, sagte er eindringlich. „Suspekt sind wir den Leviten[26 - Leviten, A.T.: die Tempeldiener aus dem Stamm Levi.] ohnedies. Wenn eines unserer Mitglieder sich nun politisch exponiert – es kann verhängnisvoll für uns sein, Ulrichs.“ Kroge trank sehr hastig seinen Kognak aus, er war sogar etwas rot geworden.
Ulrichs antwortete ruhig; „Es ist mir sehr erwünscht, Herr Direktor, dass Sie von diesen Dingen zu mir sprechen. Natürlich habe ich auch schon über sie nachgedacht. Vielleicht ist es besser, wir trennen uns, Herr Direktor – glauben Sie mir, dass es mir nicht leichtfällt, diesen Vorschlag zu machen. Aber auf meine politische Betätigung kann ich nicht verzichten. Ihr müsste ich sogar mein Engagement opfern, und das wäre ein Opfer; denn ich bin gerne hier.“ Er sprach mit einer angenehmen, dunklen und warmen Stimme. Während er redete, schaute Kroge mit einer väterlichen Sympathie auf sein intelligentes, kraftvolles Gesicht. Otto Ulrichs war ein gut aussehender Mann. Seine hohe, freundliche Stirn, von der das schwarze Haar weit zurückwich, und die engen, dunkelbraunen, gescheiten und lustigen Augen flößten Vertrauen ein. Kroge mochte ihn sehr. Deshalb wurde er jetzt beinahe zornig.
„Aber Ulrichs!“ rief er aus. „Davon kann doch gar keine Rede sein. Sie wissen ganz genau, dass ich Sie niemals fortlassen würde!“
„Wir können Sie gar nicht entbehren!“ fügte Schmilz hinzu – der dicke Mensch überraschte zuweilen durch eine merkwürdig vibrierende, helle und hübsche Stimme —; wozu die Herzfeld ernst bestätigend nickte.
„Es ist doch nur ein klein bisschen Zurückhaltung, worum ich Sie bitte“, versicherte Kroge.
Ulrichs sagte mit Herzlichkeit: „Ihr seid alle sehr nett zu mir – wirklich sehr nett – und ich werde mir Mühe geben, dass ich euch nicht gar zu sehr kompromittiere.“ Die Herzfeld lächelte ihm vertraulich zu. „Es ist Ihnen ja wohl nicht ganz unbekannt“, sagte sie leise, „dass wir politisch weitgehend mit Ihnen sympathisieren.“ – Der Mann, mit dem sie in Frankfurt verheiratet gewesen war und dessen Namen sie führte, war Kommunist. Er war viel jünger als sie und hatte sie verlassen. Zur Zeit arbeitete er in Moskau als Filmregisseur.
„Weitgehend!“ betonte Kroge mit lehrhaft erhobenem Zeigefinger. „Wenngleich nicht ganz, nicht in allen Stücken. Nicht alle unsere Träume haben sich in Moskau erfüllt. Können die Träume, die Forderungen, die Hoffnungen der Geistigen sich erfüllen unter der Diktatur?“
Ulrichs antwortete ernst, wobei seine engen Augen noch schmaler wurden und einen beinahe drohenden Blick bekamen: „Nicht nur die Geistigen – oder die, welche sich so nennen – haben ihre Hoffnungen und Forderungen. Noch dringlicher sind die Forderungen des Proletariats. Diese waren, so wie die Welt heute ist, nur zu erfüllen mittels der Diktatur.“ Hier zeigte Direktor Schmilz ein bestürztes Gesicht. Ulrichs, um dem Gespräch eine leichtere Wendung zu geben, sagte lächelnd: „Übrigens wäre auf der Versammlung gestern das Künstlertheater beinah durch sein prominentestes Mitglied repräsentiert worden. Hendrik wollte eigentlich auftreten – im letzten Augenblick ist er dann leider verhindert gewesen.“
„Höfgen wird immer im letzten Augenblick verhindert sein, wenn es sich um Angelegenheiten handelt, die bedenklich für seine Karriere werden könnten.“ Kroge hatte verächtlich den Mund verzogen, während er dies sagte. Hedda von Herzfeld sah ihn flehend und kummervoll an. Als aber Otto Ulrichs mit Überzeugung äußerte: „Hendrik gehört zu uns“, wiederholte Ulrichs. „Und er wird das durch die Tat beweisen. Seine Tat wird das Revolutionäre Theater sein. In diesem Monat soll es eröffnet werden.“
„Noch ist es nicht eröffnet.“ Kroge lächelte boshaft. „Zunächst ist nur das Briefpapier da, mit der schönen Überschrift ‘Revolutionäres Theater’. Nehmen wir aber sogar einmal an, es kommt zur Eröffnung: Glauben Sie, Höfgen wird sich heraustrauen mit einem wirklich revolutionären Stück?“
Ziemlich heftig erwiderte Ulrichs: „In der Tat glaube ich das! Übrigens ist das Stück ja schon ausgesucht – man kann wohl sagen, dass es ein revolutionäres ist.“
Kroge machte, mit der Miene und Gebärde eines müden und verächtlichen Zweifels: „Wir werden ja sehen.“ Hedda von Herzfeld, die bemerkte, dass Ulrichs rot wurde vor Ärger, fand es geraten, nunmehr das Thema zu wechseln.
„Was war das eigentlich vorhin für eine fantastische kleine Äußerung von diesem Miklas? Stimmt es also doch, dass der Bursche Antisemit ist und mit den Nationalsozialisten zu tun hat?“ Bei dem Wort „Nationalsozialisten“ verzerrte sich ihr Gesicht vor Ekel, als hätte sie eine tote Ratte berührt. Schmilz lachte verächtlich, während Kroge sagte: „So einen können wir gerade gebrauchen!“ Ulrichs versicherte sich durch einen Seitenblick, dass Miklas ihnen nicht zuhörte, ehe er mit gedämpfter Stimme erklärte:
„Hans ist im Grunde ein guter Kerl – ich weiß das, denn ich habe mich oft mit ihm unterhalten. Mit so einem Jungen muss man sich viel und nachsichtig beschäftigen – dann gewinnt man ihn vielleicht noch für die gute Sache. Ich glaube nicht, dass er für uns schon ganz verloren ist. Seine Aufsässigkeit, seine allgemeine Unzufriedenheit sind falsch gelandet – verstehen Sie, was ich meine?“ Frau Hedda nickte; Ulrichs flüsterte eifrig: „In so einem jungen Kopf ist alles wirr, alles ungeklärt – es laufen ja heute Millionen herum wie dieser Miklas. Bei denen gibt es vor allem einen Hass, und der ist gut, denn er gilt dem Bestehenden. Aber dann hat so ein Bursche Pech und fällt den Verführern in die Hände, und die verderben seinen guten Hass. Sie erzählen ihm, an allem Übel seien die Juden schuld, und der Vertrag von Versailles[27 - der Vertrag von Versailles: der am 28.6.1919 in Versailles von den Ententemächten und dem Deutschen Reich zur Beendigung des ersten Weltkrieges unterzeichnete Friedensvertrag.], und er glaubt den Dreck und vergisst, wer eigentlich die Schuldigen sind, hier und überall. Das ist das berühmte Ablenkungsmanöver, und bei all diesen jungen Wirrköpfen, die nichts wissen und nicht richtig nachdenken können, hat es Erfolg. Da sitzt dann so ein Häufchen Unglück und lässt sich Nationalsozialist schimpfen!“
Sie schauten alle vier zu Hans Miklas hin, der an einem kleinen Tisch in der entferntesten Ecke des Raumes, bei der dicken alten Souffleuse, Frau Efeu, bei Willi Bock, dem kleinen Garderobier, und bei dem Bühnenportier, Herrn Knurr, Platz genommen hatte. Von Herrn Knurr wurde behauptet, dass er ein Hakenkreuz unter dem Rockaufschlag versteckt trage und dass seine Privatwohnung voll sei von den Bildern des nationalsozialistischen „Führers“, die er in der Portiersloge denn doch nicht aufzuhängen wagte. Herr Knurr hatte heftige Diskussionen und Streitigkeiten mit den kommunistischen Bühnenarbeitern, die ihrerseits nicht im H. K. verkehrten, sondern ihren eigenen Stammtisch in einer Kneipe gegenüber hatten – wo sie zuweilen von Ulrichs besucht wurden. Höfgen wagte sich beinah nie an den Stammtisch der Arbeiter; er fürchtete, die Männer würden über sein Monokel lachen. Andererseits pflegte er zu klagen, das H. K. sei ihm durch die Anwesenheit des nationalistischen Herrn Knurr ganz verleidet. „Dieser verfluchte Kleinbürger“, sagte Höfgen von ihm, „der auf seinen Führer und Erlöser wartet wie die Jungfer auf den Kerl, der sie schwängern soll! Mir wird immer heiß und kalt, wenn ich an der Portiersloge vorbeigehen muss und an das Hakenkreuz unter seinem Rockaufschlag denke…“
„Natürlich hat er eine ekelhafte Kindheit gehabt“, sagte Otto Ulrichs, der noch bei Hans Miklas war. „Er hat mir einmal davon erzählt. Aufgewachsen ist er in irgend so einem finsteren niederbayrischen Nest. Der Vater ist im Weltkrieg gefallen, die Mutter scheint eine aufgeregte, unvernünftige Person zu sein; machte den verrücktesten Krach, als der Junge zum Theater gehen wollte – man kann sich das ja alles vorstellen. Er ist ehrgeizig, fleißig, auch begabt; er hat enorm viel gelernt, mehr als die meisten von uns. Ursprünglich wollte er Musiker werden, er hat den Kontrapunkt gelernt, und er kann Klavier spielen, und er kann Akrobatik und Steptanzen und Ziehharmonika und überhaupt alles. Er arbeitet den ganzen Tag, dabei ist er wahrscheinlich krank, sein Husten klingt scheußlich. Natürlich findet er, dass er zurückgesetzt wird und nicht genügend Erfolg hat, und schlechte Rollen. Er glaubt, wir sind verschworen gegen ihn, von wegen seiner so-genannten politischen Gesinnung.“ Ulrichs schaute noch immer, aufmerksam und ernst, zum jungen Miklas hinüber. „95 Mark Monatsgehalt“, sagte er plötzlich und blickte drohend auf Direktor Schmilz, der sofort unruhig auf seinem Stuhl zu rücken begann, „es ist schwer, dabei ein anständiger Mensch zu bleiben.“ Nun schaute auch die Herzfeld aufmerksam zu Miklas hinüber.
Zum Garderobier Bock, zur Souffleuse Efeu und Herrn Knurr pflegte Hans Miklas sich stets dann zu setzen, wenn er sich recht niederträchtig benachteiligt fand von der Direktion des Künstlertheaters, die er vor seinen politischen Freunden als „verjudet“ und „marxistisch“ bezeichnete. Vor allem hasste er Höfgen, diesen „ekelhaften Salonkommunisten“. Höfgen war, wenn man Miklas glauben durfte, eifersüchtig und eitel; Höfgen war größenwahnsinnig und wollte alles spielen, besonders aber spielte er ihm, Miklas, die Rollen weg. „Es ist eine Gemeinheit, dass er mir den Moritz Stiefel nicht gelassen hat“, äußerte der Verbitterte. Miklas schaute zornig auf seine eigenen Beine, die mager und sehnig waren.
Garderobier Bock, ein dummer Bursche mit wässrigen Augen und sehr blonden, sehr harten Haaren, die er kurz geschoren wie eine Bürste trug, kicherte über seinem Bierglas: niemand wusste, ob über Hendrik Höfgen, der als Gymnasiast komisch aussehen würde, oder über den machtlosen Zorn des jungen Hans Miklas. Die Souffleuse Efeu hingegen zeigte Entrüstung; sie bestätigte Miklas, dass es eine Gemeinheit sei. Das mütterliche Interesse, das die dicke alte Person an dem jungen Menschen nahm, brachte für diesen praktische Vorteile mit sich. Übrigens sympathisierte sie auch politisch mit ihm. Sie stopfte ihm seine Socken, lud ihn zum Abendessen ein; schenkte ihm Wurst, Schinken und Eingemachtes. „Damit du dicker wirst, Junge“, sagte sie und schaute ihn zärtlich an. Dabei gefiel ihr gerade die Magerkeit seines trainierten, nicht sehr großen, elastischen, schmalen Körpers. Wenn sein dichtes dunkelblondes Haar am Hinterkopf gar zu widerspenstig in die Höhe stand, sagte die Efeu: „Du siehst aus wie ein Gassenjunge!“ und holte einen Kamm aus dem Beutel.
Wie ein Gassenjunge sah Hans Miklas wirklich aus, freilich wie einer, dem es nicht besonders gut geht und der seine Angegriffenheit trotzig bezwingt. Sein Leben war anstrengend; er trainierte den ganzen Tag, mutete seinem schmalen Körper vieles zu, wahrscheinlich kamen daher seine Reizbarkeit und der finster abweisende Ausdruck seines jungen Gesichtes. Dieses Gesicht hatte üble Farben; unter den starken Backenknochen gab es schwarze Löcher, so eingefallen waren die Wangen. Um die hellen Augen waren die Ränder auch beinah schwarz. Hingegen war die reine, kindliche Stirne wie beschienen von einer bleichen und empfindlichen Helligkeit; auch der Mund leuchtete, aber auf ungesunde Art, viel zu rot; in den abweisend vorgeschobenen Lippen schien sich alles Blut zu sammeln, von dem das Gesicht sonst leer war. Unter den starken und verführerischen Lippen, von denen die Souffleuse Efeu oft den Blick nicht lassen konnte, enttäuschte das zu kurze, schwächlich abfallende Kinn.
„Heute früh, auf der Probe, hast du wieder ganz zum Fürchten ausgesehen“, sprach die Efeu besorgt. „So schwarze, tiefe Löcher in den Backen! Und der Husten! Dumpf hat der geklungen – zum Erbarmen!“
Miklas konnte es nicht ausstehen, wenn man ihn bemitleidete; nur die Gaben, in die solches Mitleid sich umsetzte, nahm er gerne, wenngleich wortkarg entgegen. Das klagende Gerede der Efeu überhörte er einfach. Hingegen wollte er von Bock wissen: „Stimmt es, dass der Höfgen sich heute den ganzen Abend in seiner Garderobe hinter dem Paravent versteckt hat?“
Bock konnte es nicht in Abrede stellen. Miklas fand Höfgens Betragen derartig albern, dass es ihn geradezu in Heiterkeit versetzte, „Ich sage doch, ein kompletter Narr!“ Dabei lachte er triumphierend. „Und das alles wegen einer Jüdin, der der Kopf bis dahin zwischen den Schultern steckt!“ Er machte sich bucklig, um anzudeuten, wie die Martin aussehe: die Efeu amüsierte sich herzlich. „Und so etwas will ein Star sein!“ Mit seinem höhnischen Ausruf konnte er ebensowohl die Martin meinen wie Höfgen. Beide gehörten, nach seinem Urteil, in dieselbe bevorzugte, undeutsche, tief verwerfliche Clique. „Die Martin!“ redete er weiter, das böse, leidende, reizvolle junge Gesicht in die mageren, nicht ganz sauberen Hände gestützt. „Sie soll ja auch immer diese salonkommunistischen Phrasen dreschen, mit ihren tausend Mark jeden Abend. Eine Bande ist das! Aber es wird aufgeräumt werden mit denen – der Höfgen wird auch noch dran glauben müssen!“
Das enge Lokal war voll Rauch. „Die Luft ist ja dick zum Schneiden“, klagte die Motz. „Das hält doch der stärkste Mann nicht aus. Und meine Stimme! Kinder, morgen könnt ihr mich wieder beim Halsarzt sitzen sehen.“ Niemand hatte Lust, sie sitzen zu sehen. Rahel Mohrenwitz machte sogar ironisch: „Huch, unsere Koloratursängerin!“ – wofür sie einen fürchterlichen Blick von der Motz bekam, die sowieso etwas gegen Rahel hatte: Petersen wusste, warum. Erst gestern wieder hatte man ihn in der Garderobe des dämonischen Mädchens gefunden, und die Motz hatte weinen müssen. Heute aber schien sie entschlossen, sich keinesfalls die Stimmung verderben zu lassen von einer dummen Gans, die sich vielleicht auf ihr Monokel und ihre lächerliche Frisur noch was einbildete. Vielmehr faltete sie die Hände vor dem Bauch und markierte gemütliche Stimmung. „Aber nett ist es hier“, sagte sie herzlich. „Was, Vater Hansemann?“ Sie blinzelte dem Wirt zu, dem sie noch 27 Mark schuldete und der deshalb nicht zurückblinzelte. Gleich danach entsetzte sie sich, weil Petersen sich ein Beefsteak servieren ließ, noch dazu mit Spiegelei. „Als ob ein Paar Würstchen nicht genügt hätten!“ Ihr standen Tränen des Zorns in den Augen. Zwischen Motz und Petersen gab es viel Streit und Hader, weil der Väterspieler, nach dem Dafürhalten seiner Freundin, zur Verschwendungssucht neigte. Immer bestellte er sich teure Sachen, und die Trinkgelder, die er spendierte, waren auch zu hoch. „Natürlich: Steak mit Ei muss es sein!“ jammerte die Motz. Petersen murmelte, dass ein Mann sich doch anständig ernähren müsse. Die Motz aber, ganz außer Fassung, fragte plötzlich mit zornigem Sarkasmus die Mohrenwitz, ob Petersen ihr vielleicht eine Flasche Sekt angeboten habe. „Veuve Cliquot, extrafein!“ schrie die Motz und sprach, bei aller Gehässigkeit, den Namen der Sektmarke mit jener Delikatesse aus, welche sie als Salondame legitimierte. Hierüber war die Mohrenwitz nun ernsthaft beleidigt. „Ich muss doch sehr bitten!“ rief sie schrill. „Soll das ein Witz sein?!“ Das Monokel fiel ihr aus dem Auge, ihr pausbäckiges, vor Ärger rot gewordenes Gesicht sah plötzlich gar nicht mehr dämonisch aus. Kroge blickte schon verwundert auf; Frau von Herzfeld lächelte ironisch. Der schöne Bonetti aber klopfte der Motz auf die Schulter; gleichzeitig auch der Mohrenwitz, die kampfeslustig näher getreten war. „Zankt euch nicht, Kinder!“ riet er ihnen, um den Mund besonders müde und angewiderte Falten. „Dabei kommt doch nichts raus. Spielen wir lieber Karten.“
In diesem Augenblick wurden gedämpfte Rufe laut, und alles drehte sich der Türe zu, die sich geöffnet hatte. Dora Martin stand auf der Schwelle. Hinter ihr drängte sich, wie auf der Bühne das Gefolge hinter der Königin, das Ensemble, mit dem sie reiste.
Dora Martin lachte und winkte allen Mitgliedern des Hamburger Künstlertheaters zu; dabei rief sie mit ihrer heiteren Stimme, auf jene berühmte Alt, die von tausend jungen Schauspielerinnen im ganzen Lande kopiert wurde, in jedem Satz einige Worte zerdehnend: „Kinder, wir sind eingeladen, ein ganz langweiliges Bankett, furchtbar schade, aber wir müssen hingehen!“ Sie schien ihre eigene Sprechweise parodieren zu wollen, so eigenwillig verfuhr sie mit der Länge der Silben. Aber allen klang es lieblich in den Ohren, auch denen, welche die Martin nicht leiden konnten, zum Beispiel dem jungen Miklas. Es war nicht zu leugnen: Ihr Auftritt hatte großen Effekt gemacht.
Da geschah es, dass jemand hinter ihr sich durchs Gefolge drängte. Es war Hendrik Höfgen, der unvermittelt hervorkam. Er hatte den Smoking an, den er in mondänen Rollen auf der Bühne trug und der, aus der Nähe betrachtet, schon recht abgetragen und fleckig wirkte. Über den Schultern lag ihm ein weißes Seidentuch. Sein Atem flog; Wangen und Stirne waren hektisch gerötet. Einen recht beunruhigenden Eindruck machte das nervöse Lachen, das ihn schüttelte, während er sich in gehetzter Eile, umflattert vom Seidentuch, tief über die Hand der Diva bückte, und das nicht ohne eine gewisse irrsinnige Herzlichkeit schien. „Entschuldigen Sie“, brachte er hervor. „Es ist ja fantastisch: ich bin viel zu spät – was müssen Sie von mir denken – eine fantastische Sache…“ Das Lachen beutelte ihn, sein Gesicht wurde immer röter. „Aber ich wollte Sie doch nicht gehen lassen“, dabei richtete er sich endlich auf, „ohne Ihnen gesagt zu haben, wie sehr ich diesen Abend genossen habe – wie wunderschön es gewesen ist!“ Plötzlich schien die ungeheuer komische Angelegenheit, über die er fast zersprungen war vor Lachen, nicht mehr zu existieren; er zeigte nun ein ganz ernstes Gesicht.
Dafür war es jetzt an Dora Martin, ein wenig zu lachen, und das tat sie denn auch, besonders heiser und zauberhaft.
„Schwindler!“ rief sie, und von dem eigensinnig gedehnten „i“ kam sie gar nicht mehr weg. „Sie sind gar nicht im Theater gewesen! Sie haben sich ja versteckt!“ Dabei schlug sie ihn leicht mit dem gelben, schweinsledernen Handschuh. „Aber das macht nichts“, strahlte sie ihn an. „Sie sollen ja so begabt sein.“
Über diese Feststellung, die überraschend kam, erschrak Höfgen zunächst so stark, dass die helle Röte von seinem Gesicht wich, welches fahl wurde. Dann aber sagte er, mit einer Stimme, die schmelzend klang: „Ich? Begabt? Das ist doch ein ganz unbewiesenes Gerücht…“
Die Vokale konnte auch er zerdehnen, nicht nur Dora Martin brachte dies fertig. Seine Sprachkoketterie hatte eigenen Stil, er war keineswegs darauf angewiesen, irgend jemanden zu kopieren. Dora Martin girrte; er aber sang vor Manieriertheit. Dabei zeigte er jenes Lächeln, das er auf den Proben den Damen vorzumachen pflegte, wenn sie verfängliche Szenen zu spielen hatten: Es entblößte die Zähne und war ziemlich gemein. Er bezeichnete es als das „aasige“ Lächeln. („Aasiger – verstehst du, meine Liebe? —, aasiger!“ mahnte er auf den Proben Rahel Mohrenwitz oder Angelika Siebert, und er machte es vor.)
Ihre Zähne zeigte auch Dora Martin; er während der Mund „babytalk“ sprach und der Kopf kokett zwischen den hochgezogenen Schultern steckte, forschten ihre großen, klugen, unbetrügbaren und traurigen Augen in Höfgens Gesicht. „Sie werden es schon noch beweisen, Ihr Talent!“ sagte sie leise, und eine Sekunde lang war nicht nur ihr Blick ernst, sondern auch ihr Gesicht. Ernsten Gesichtes, beinah drohend, nickte sie ihm zu. Höfgen, der sich noch vor einer Viertelstunde hinterm Paravent versteckt hatte, hielt ihren Blick aus. Dann lachte die Martin wieder; girrte: „Wir sind viel zu spät!“; winkte und entschwand mit Gefolge. Höfgen war in die Kantine getreten.
Die Begegnung mit Dora Martin hatte ihn auf wunderbare Art aufgeheitert; er schien jetzt in einer geradezu festlichen Laune zu sein. Von seinem Antlitz kam ein gnädiger Glanz. Alle schauten auf ihn, nun beinah ebenso bezwungen, wie sie vorhin auf die Berliner Diva geschaut hatten. – Ehe Höfgen Direktor Kroge und Frau von Herzfeld begrüßte, war er zu Garderobier Bock getreten. „Hör mal, mein Böckchen“, sang er und stand verführerisch da: Hände in die Hosentaschen vergraben, Schultern hochgezogen, und auf den Lippen das aasige Lächeln. „Du musst mir mindestens sieben Mark fünfzig leihen. Ich will anständig zu Abend essen, und ich habe so ein Gefühl: Väterchen Hansemann verlangt heute Barbezahlung.“ Aus den schillernden Edelsteinaugen warf er einen misstrauisch schiefen Blick auf Hansemann, der mit blauroter Nase unbewegt hinter der Theke saß. Bock war aufgesprungen; aus Schreck über Höfgens einerseits ehrenvolles, andererseits grausiges Ansinnen waren seine Augen noch wässriger, seine Wangen dunkelrot geworden. Während er stumm erregt in den Taschen wühlte und Hans Miklas mit gehässig gespanntem Blick den ganzen Vorfall beobachtete, war die kleine Angelika eilig hinzugetreten. „Aber Hendrik!“ sagte sie schnell und schüchtern. „Wenn du Geld brauchst – ich kann dir doch fünfzig Mark bis zum Ersten leihen!“ Sofort bekam Höfgen fischig kalte Augen. Er sagte hochmütig über die Schulter: „Mische dich nicht in unsere Männergeschäfte, meine Kleine. Bock gibt gerne.“ Der Garderobier nickte aufgeregt, während sich die Siebert mit nassen Augen zurückzog. Höfgen ließ, ohne sich zu bedanken, Bocks Silbermünzen nachlässig in seine Tasche gleiten. Miklas, Knurr und die Efeu schauten finster, Bock fassungslos und Angelika weinend hinter ihm drein, während er wiegenden Ganges, immer noch das weiße Seidentuch über den Schultern, das Lokal durchschritt. „Väterchen Schmilz lässt mich nämlich verhungern“, erklärte er, das sieghaft lächelnde Gesicht dem Direktorentisch zugewandt.
Dort wurde er mit einigem Hallo empfangen; sogar Kroge zwang sich zu einer etwas lärmenden und nicht ganz echten Herzlichkeit. „Na, alter Sünder, wie geht’s? Haben Sie den Abend gut überstanden?“ Er bekam scharfe Falten um den Katermund, fast wie die Motz, und falsche Augen hinter den Brillengläsern; plötzlich war ihm anzumerken, dass er nicht nur kulturpolitische Essays und hymnische Lyrik schrieb, sondern seit über dreißig Jahren mit dem Theater zu tun hatte. – Höfgen und Otto Ulrichs schüttelten sich vertraut, stumm und ausführlich die Hände. Direktor Schmilz sagte etwas belanglos Scherzhaftes, mit seiner überraschend weichen, angenehmen Stimme; Frau von Herzfeld aber lächelte grundlos ironisch, wobei ihre goldbraunen Augen, feucht vor Innigkeit und fast flehend, auf Hendrik gerichtet waren. Er ließ sich von ihr bei der Auswahl seines Abendessens beraten, was ihr Anlass gab, an ihn heranzurücken und ihren schweratmenden Busen in seine Nähe zu bringen. Sein aasiges Lächeln schien sie nicht abzuschrecken: Sie war es gewohnt, und es gefiel ihr.
Als Väterchen Hansemann die Bestellung entgegengenommen hatte, fing Höfgen an, von seiner „Frühlings Erwachen“[28 - „Frühlings Erwachen“: ein Drama von Frank Wedekind.] – Inszenierung zu sprechen. „Es wird anständig werden, glaube ich“, sagte er ernst; dabei glitten seine prüfenden Augen durch das Lokal, über die Schauspieler hin, wie die Augen eines Feldherrn über Truppen. „An der Wendla kann die Siebert nichts verderben; Bonetti ist kein idealer Melchior Gabor, aber er schafft es; unsere dämonische Mohrenwitz legt eine erstklassige Ilse hin.“ – Es geschah nicht sehr häufig, dass er ohne Mätzchen redete, sondern ernsthaft und um der Sache willen wie eben jetzt. Kroge lauschte ihm achtungsvoll, nicht ohne Überraschung. Es war die Herzfeld, welche die Stimmung wieder verdarb, indem sie sarkastisch-schmeichlerisch, ihr großes, flaumiggepudertes Gesicht ziemlich nahe bei Höfgen, bemerkte: „Nun, und was den Moritz Stiefel betrifft – da wurde ja gerade von berufenster Seite, von Dora selber, festgestellt, dass der junge Schauspieler, dem wir diese Rolle anvertraut haben, nicht ganz unbegabt ist…“ Kroge runzelte missbilligend die Stirne; Höfgen seinerseits schien die Neckerei zu überhören. „Und wie werden Sie eigentlich als Frau Gabor, meine Teure?“ fragte er die Herzfeld ins Gesicht. Dies war offener und derber Hohn. Dass Frau Hedda eine unbegabte Schauspielerin war, gehörte zu den bekannten Tatsachen; auch wusste jeder, dass sie darunter litt. Man spottete gern darüber, dass die kluge Dame es nicht lassen konnte, aufzutreten, und sei es auch nur in bescheidenen Mütterrollen. Auf Hendriks Ungezogenheit hin versuchte sie, gleichgültig die Achseln zu zucken; dabei aber zog eine ins Violette spielende Röte über die große Fläche ihres unjungen Gesichts. Kroge sah es, und sein Herz zog sich zusammen in einem Mitleid, das nicht weit von Zärtlichkeit war. Kroge hatte vor vielen Jahren ein Verhältnis mit Frau von Herzfeld gehabt.
Um das Thema zu wechseln oder um auf das einzige Thema zu kommen, das ihn wirklich beschäftigte, begann Ulrichs ohne Übergang vom Revolutionären Theater zu sprechen.
Das Revolutionäre Theater war geplant als eine Serie von Sonntag-Vormittag-Veranstaltungen, die unter der Leitung Hendrik Höfgens und dem Protektorat einer kommunistischen Organisation stehen sollten. Ulrichs, für den die Bühne zunächst und vor allem ein politisches Instrument bedeutete, hing mit zäher Leidenschaft an diesem Projekt. Das Stück, das man für die Eröffnungsvorstellung ausgesucht habe, eigne sich glänzend, sagte er nun, er habe es noch einmal genau durchgearbeitet. „Man interessiert sich in der Partei sehr ernsthaft für unsere Sache“, erklärte er und schaute mit einem bedeutungsvollen Verschwörerblick auf Höfgen, an Kroge, Schmilz und der Herzfeld vorbei, aber doch stolz darauf, dass sie es hörten und dass es sie beeindrucken würde. – „Nun, die Partei wird mir keinen Schadenersatz zahlen, wenn die guten Hamburger mir dann mein Haus boykottieren“, brummte Kroge, den der Gedanke an das Revolutionäre Theater immer skeptisch und verdrießlich stimmte. „Ja“, sagte er noch, „1918 – da konnte man sich solche Experimente leisten. Aber heute…“ Höfgen und Ulrichs tauschten einen Blick, der ein hochmütiges und geheimes Einverständnis enthielt und viel Geringschätzung für die kleinbürgerlichen Bedenken ihres Direktors. Der Blick dauerte ziemlich lange, Frau von Herzfeld bemerkte ihn und litt. Schließlich wendete sich Höfgen, etwas väterlich herablassend, an Kroge und Schmilz. „Das Revolutionäre Theater wird uns nicht schaden – sicher nicht – glauben Sie es nur, Väterchen Schmilz! Was wirklich gut ist, kompromittiert einen niemals. Das Revolutionäre Theater wird gut, es wird glänzend! Eine Leistung, hinter der ein echter Glaube, ein wirklicher Enthusiasmus steht, überzeugt alle – auch die Feinde werden verstummen vor dieser Manifestation unserer glühenden Gesinnung.“ Seine Augen schillerten, schielten ein wenig und schienen verzückt in Fernen zu schauen, wo die großen Entscheidungen fallen. Das Kinn hielt er stolz gereckt; auf dem fahlen, nach hinten geneigten, empfindlichen Antlitz lag ein siegesgewisser Glanz. ,Das ist wirkliche Ergriffenheit’, dachte Hedda von Herzfeld. ,Das kann er nicht spielen – so begabt er auch ist.’ Triumphierend sah sie Kroge an, der eine gewisse Bewegtheit nicht verbergen konnte. Ulrichs machte eine feierliche Miene.
Während alle noch gebannt saßen von den Effekten seines rührenden Enthusiasmus, änderte Höfgen plötzlich Haltung und Ausdruck. Er begann überraschend zu lachen und deutete auf die Fotografie eines „Heldenvaters“, die über dem Tisch an der Wand hing: die Arme drohend verschränkt, biederer Blick unter finsterer Braue, breiter Vollbart, sorgfältig ausgebreitet auf einem phantastischen Jägerwams. Hendrik konnte sich gar nicht darüber beruhigen, wie drollig er den alten Burschen fand. Unter vielem Gelächter, nachdem Hedda ihm den Rücken geklopft hatte, weil er am Salat zu ersticken drohte, brachte er hervor, dass er selber ganz ähnlich, ja, fast genauso ausgesehen habe – als er nämlich noch die Väterrollen gespielt hatte, an der Norddeutschen Wanderbühne.
„Als ich noch ein Knabe war“, jubelte Hendrik, „da sah ich doch so phantastisch alt aus. Und auf der Bühne ging ich immer gebückt vor lauter Verlegenheit. In den ,Räubern’[29 - „Die Räuber“: ein Drama von Friedrich Schiller.] ließ man mich den alten Moor spielen. Ich war ein hervorragend guter alter Moor. Jeder von meinen Söhnen war zwanzig Jahre älter als ich.“
Da er so laut lachte und von der Norddeutschen Wanderbühne sprach, eilten von allen Tischen die Kollegen herbei: Man wusste, dass nun Anekdoten kommen würden, und zwar keine abgestandenen alten, sondern neue, und wahrscheinlich ziemlich gute – es geschah selten, dass Hendrik sich wiederholte.
Es wurde ein reizender Abend. Höfgen war blendend in Form. Er bezauberte, er brillierte. Als hätte er ein großes Publikum vor sich, anstatt nur die paar geringen Kollegen, verschwendete er, großmütig-übermütig, Witz, Charme und Anekdotenschatz. Was war nicht alles an dieser Wanderbühne passiert, wo er die Väterrollen hatte spielen müssen! Die Motz bekam schon Atemnöte vor Lachen. „Kinder, ich kann nicht mehr!“ schrie sie, und da Bonetti ihr drollig-galant mit dem Tüchlein fächelte, übersah sie, dass Petersen sich schon wieder Schnaps bestellte. Als Höfgen aber dazu überging, mit schriller Stimme, flatternden Gesten und unheimlich schielenden Augen die jugendliche Sentimentale der Wanderbühne nachzuahmen, da verzog sogar Vater Hansemann die starre Miene, und Herr Knurr musste sein Grinsen hinter dem Taschentuch verbergen. Mehr Triumph war nicht herauszuholen aus der Situation. Höfgen brach ab. Auch die Motz wurde ernst, da sie feststellte, wie besoffen Petersen war. Kroge gab das Zeichen zum Aufbruch. Es war zwei Uhr morgens. Zum Abschied schenkte die Mohrenwitz, die immer originelle Einfälle hatte, Hendrik ihre lange Zigarettenspitze, ein dekoratives, übrigens wertloses Stück. „Weil du heute abend so enorm amüsant gewesen bist, Hendrik.“ Ihr Monokel blitzte sein Monokel an. Man sah, dass Angelika Siebert, die neben Bonetti stand, vor Eifersucht eine weiße Nase bekam, und dazu Augen, die tränenvoll und gleichzeitig ein wenig tückisch waren.
Frau von Herzfeld hatte Hendrik aufgefordert, noch eine Tasse Kaffee mit ihr zu trinken. Im leeren Lokal machte Vater Hansemann schon die Lampen aus. Für Hedda war das Halbdunkel vorteilhaft: Ihr großes, weiches Gesicht mit den sanften, klug beseelten Augen erschien nun jünger, oder doch alterslos. Dieses war nicht mehr das betrübte Antlitz der alternden, intellektuellen Frau. Die Wangen wirkten nicht mehr flaumig, sondern glatt. Das Lächeln um die orientalisch trägen, halbgeöffneten Lippen war nicht mehr ironisch, sondern fast verführerisch. Still und zärtlich schaute Frau von Herzfeld auf Hendrik Höfgen. Sie dachte nicht daran, dass sie selber reizvoller aussah als sonst; nur dass Hendriks Gesicht mit dem angestrengten Leidenszug an den Schläfen und dem edlen Kinn blass und deutlich in der Dämmerung stand, merkte sie und genoss sie.
Hendrik hatte seine Ellenbogen auf den Tisch gestützt und die Fingerspitzen seiner ausgestreckten Hände gegeneinander gelegt. Diese anspruchsvolle Haltung leistete er sich wie einer, der besonders schöne, gotisch spitze Hände hat. Höfgens Hände waren aber keineswegs gotisch; vielmehr schienen sie den Leidenszug der Schläfen durch ihre unschöne Derbheit widerlegen zu wollen. Die Handrücken waren sehr breit und rötlich behaart; breit waren auch die ziemlich langen Finger, die in eckigen, nicht ganz sauberen Nägeln endeten. Gerade diese Nägel waren es wohl, die den Händen ihren unedlen, beinah unappetitlichen Charakter gaben. Sie schienen aus minderwertiger Substanz zu sein: bröckelig, spröde, ohne Glanz, ohne Form und Wölbung.
Diese Schadhaftigkeiten und Mängel aber verbarg die vorteilhafte Dämmerung. Hingegen ließ sie das träumerische Schielen der grünlichen Augen rätselhaft und reizend wirken.
„Woran denken Sie, Hendrik?“ fragte die Herzfeld, nach langem Schweigen, mit einer innig gedämpften Stimme.
Ebenso leise antwortete Höfgen: „Ich denke daran – dass Dora Martin unrecht hat…“ Hedda ließ ihn, über seine aneinandergelegten Hände hinweg, ins Dunkel reden, ohne zu fragen oder zu widersprechen. „Ich werde mich nicht beweisen“, klagte er in die Dämmerung. „Ich habe nichts zu beweisen. Niemals werde ich erstklassig sein. Ich bin provinziell.“ Er verstummte, presste die Lippen aufeinander, als erschräke er selber vor den Erkenntnissen und Bekenntnissen, zu denen die sonderbare Stunde ihn brachte.
„Und weiter?“ fragte Frau von Herzfeld mit sanftem Vorwurf. „Und weiter denken Sie nichts? Immer nur daran?“ Da er stumm blieb, dachte sie: ,Ja – dieses ist wohl das einzige, was ihn wirklich beschäftigt. Das mit dem politischen Theater vorhin und sein Enthusiasmus für die Revolution – das war also auch nur Komödie.’ Diese Entdeckung erfüllte sie mit Enttäuschung; irgendwo fühlte sie sich aber auch auf eine merkwürdige Art von ihr befriedigt. Er ließ mysteriös die Augen schillern; eine Antwort hatte er nicht.
„Merken Sie denn nicht, wie Sie die kleine Angelika quälen?“ fragte die Frau neben ihm. „Spüren Sie denn nicht, dass Sie – andere leiden machen? Irgendwo müssen Sie doch für all das bezahlen.“ Sie ließ den klagenden und suchenden Blick nicht von ihm. „Irgendwo müssen Sie doch büßen – und lieben.“
Nun war es ihr doch peinlich, dass sie dies gesagt hatte. Es war entschieden zuviel, sie hatte sich gehen lassen. Schnell entfernte sie ihr Gesicht von seinem. Zu ihrem Erstaunen bestrafte er sie durch kein böses Grinsen, durch kein höhnisches Wort. Vielmehr blieb sein Blick schielend, schillernd und starr, ins Dunkel gerichtet, als suchte er dort Antwort auf dringliche Fragen, Stillung seiner Zweifel und das Bild einer Zukunft, deren eigentlicher Sinn es war, ihn groß zu machen.
II
Die Tanzstunde
Für den nächsten Tag hatte Hendrik den Beginn der Probe auf halb zehn Uhr angesetzt. Pünktlich versammelte sich das Ensemble, soweit es in „Frühlings Erwachen“ beschäftigt war, teils auf der zugigen Bühne, teils im spärlich beleuchteten Parkett. Nachdem man etwa eine Viertelstunde lang gewartet hatte, entschloss sich Frau von Herzfeld dazu, Höfgen aus dem Büro zu holen, wo er sich seit neun Uhr mit den Direktoren Schmilz und Kroge besprach.
Gleich bei seinem Eintritt waren sich alle darüber klar, dass er sich heute in der ungnädigsten Stimmung befand – der strahlende Causeur vom vorigen Abend war nicht wiederzuerkennen. Die Schultern auf nervöse Art hochgezogen, die Hände in den Hosentaschen vergraben, ging er eilig durch das Parkett und bat, mit einer vor Gereiztheit fast tonlosen Stimme, um ein Exemplar des Textbuches. „Ich habe meines zu Hause liegenlassen.“ Er hatte einen bitter gekränkten Ton, der gleichsam allen Anwesenden einen leisen, aber intensiven Vorwurf aus dem Umstand machte, dass er, Hendrik, beim Weggehen vergesslich und zerstreut gewesen war. „Nun, darf ich bitten?“ Es gelang ihm, zugleich wegwerfend gedämpft und sehr schneidend zu sprechen. „Hat denn niemand so ein Heftchen für mich?“
Die kleine Angelika reichte ihm das ihre. „Ich brauche mein Buch nicht mehr“, sagte sie errötend. „Ich kann meinen Text.“
Hendrik, anstatt sich zu bedanken, bemerkte kurz: „Das will ich auch hoffen!“ – und wandte sich von ihr ab.
Über dem roten Seidenschal, den er statt eines Hemdes trug – oder der doch das Hemd, falls er ein solches anhatte, versteckte —, wirkte sein Gesicht besonders fahl. Das eine Auge schaute, unter halb gesenktem Lid, verächtlich und böse; vor dem anderen blitzte das Monokel. Als er mit einer plötzlich ganz hellen, durchdringenden und etwas klirrenden Kommandostimme rief: „Anfangen, Herrschaften!“ – zuckte alles zusammen.
Er rannte im Zuschauerraum umher, während auf der Bühne gearbeitet wurde. Den Moritz Stiefel – die Rolle, welche er sich selber vorbehalten hatte – ließ er von Miklas, dem seine eigene Partie nur sehr wenig zu tun gab, markieren. Darin konnte man eine besondere Bosheit sehen, da der arme Miklas doch seinerseits den Moritz, für sein Leben gerne gespielt hätte. Übrigens schien Höfgen, mit provokantem Hochmut, den Kollegen andeuten zu wollen, dass er seinerseits es keineswegs nötig habe, irgend etwas zu probieren oder vorzubereiten: er war der Regisseur, stand über dem Ganzen; seine Routine war so groß wie sein Genie, die eigene Rolle erledigte er nebenbei; erst auf der Generalprobe würde man es von ihm zu sehen und zu hören bekommen, wie Moritz Stiefel, der düstere Gymnasiast, der verzweifelt liebende, der Selbstmörder aufzufassen und zu spielen sei.
Hingegen bekam man es jetzt schon von ihm gezeigt, was man aus dem Mädchen Wendla, dem Knaben Melchior, der mütterlichen Frau Gabor machen konnte. Hendrik sprang, mit einer überraschenden Behendigkeit, auf die Bühne, und wirklich: er verwandelte sich in das zarte Mädchen, das in den morgendlichen Garten tritt und die ganze Welt umarmen möchte, da sie an den Geliebten denkt; in den lebenshungrigen und stolzen Knaben; in die kluge, sorgenvolle Mutter. Seine Stimme konnte zärtlich, übermütig oder gedankenvoll klingen. Es gelang ihm, in diesem Augenblick kindlich jung auszusehen, im nächsten aber uralt. Er war ein glänzender Schauspieler.
Wenn er es dem schönen Bonetti, der die Brauen halb verärgert, halb achtungsvoll hochzog, oder der demütigen Angelika, die gegen Tränen kämpfte, eindrucksvoll demonstriert hatte, was man mit ihren Rollen eigentlich anfangen könnte, wenn man nur das Zeug dazu hätte, schnitt er eine müde und verächtliche Grimasse, klemmte sich das Monokel vors Auge und stieg ins Parkett zurück. Von dort aus erklärte, arrangierte und kritisierte er weiter. Keiner blieb verschont von seinen höhnisch herabsetzenden Worten, sogar Frau von Herzfeld wurde abgekanzelt – was sie mit einem verzerrt-ironischen Lächeln hinnahm —; die kleine Angelika hatte sich schon mehrmals tränenüberströmt in die Kulisse zurückgezogen; auf Bonettis Stirne zeigten sich Zornesadern; am tiefsten und leidenschaftlichsten aber ärgerte sich Hans Miklas, dessen Gesicht vor Zorn zu verfallen und schwarze Löcher zu bekommen schien.
Da alle litten, wurde Hendrik zusehends besserer Laune. Während der Mittagspause, in der Kantine, unterhielt er sich recht angeregt mit Frau von Herzfeld. Um halb drei Uhr ließ er die Gesellschaft wieder zur Arbeit antreten. Es war gegen halb vier Uhr, als der schöne Bonetti seinen angewiderten Zug um den Mund bekam, die Hände in die Hosentaschen steckte und gnauzend wie ein verwöhntes Kind sagte: „Ist denn noch nicht bald Schluss mit der Schinderei?“ Daraufhin warf Höfgen ihm einen vernichtenden Blick zu aus seinen weichen und eiskalten Augen. Er sagte: „Wann aufgehört wird, das bestimme allein ich!“ und hielt das schöne Kinn besonders hoch gereckt. Dem eingeschüchterten Ensemble zeigte er das Antlitz eines edlen und nervösen Tyrannen. „Weitermachen, Herrschaften!“ rief er, wobei seine Stimme den hellen Metallton hatte, dem fast niemand widerstehen konnte. „Wo haben wir unterbrochen?“
Man probierte folgsam die nächste Szene, war aber kaum mit ihr zu Ende gekommen, als Hendrik seinerseits einen Blick auf die Armbanduhr warf. Sie zeigte ein Viertel vor vier Uhr: Während er es feststellte, erschrak er, und zwar so heftig, dass es weh im Magen tat. Ihm war eingefallen, dass er um vier Uhr eine Verabredung mit Juliette in seiner Wohnung hatte. Sein Lächeln war etwas krampfhaft, als er dem Ensemble mit hastigfreundlichen Worten mitteilte, nun müsse Schluss gemacht werden. Dem jungen Miklas, der sich ihm mürrischen Gesichtes nahte, um irgendeine Frage zu stellen, winkte er eilig ab. Er rannte durch das dunkle Parkett dem Ausgang zu; legte das steile Stück Weges, das zwischen dem Theaterportal und der Kantine lag, laufend zurück; langte atemlos im H. K. an; riss dort seinen braunen Ledermantel und den weichen grauen Hut vom Nagel und war schon davon.
Die altmodische Villa, in deren Erdgeschoß er ein Zimmer bewohnte, lag in einer jener stillen Straßen, die vor dreißig Jahren zu den vornehmsten der Stadt gehört hatten. Mit der Inflation waren die meisten Bewohner der feinen Gegend arm geworden; ihre Villen mit den vielen Zinnen und Giebeln sahen schon recht heruntergekommen aus – verwahrlost, wie die großen Gärten, die sie umgaben. Auch Frau Konsul Mönkeberg, der Hendrik monatlich vierzig Mark für eine geräumige Stube bezahlte, fand sich in bedrängten Verhältnissen. Trotzdem war sie eine tadellose, stolze alte Dame geblieben, die ihre sonderbaren Kostüme mit Puffärmeln und Spitzenumhang würdevoll trug, auf deren glattem Scheitel niemals ein Haar sich widerspenstig zu zeigen wagte und um deren schmale Lippen ironische, aber nicht bittere Fältchen spielten.
Hendrik fühlte sich unsicher in der Gegenwart der Dame Mönkeberg; ihre vornehme Herkunft und Vergangenheit schüchterten ihn ein. So war es ihm auch jetzt durchaus nicht angenehm, der feinen Alten im Vestibül zu begegnen, nachdem er gerade die Haustür so krachend hinter sich ins Schloss geworfen hatte. Angesichts ihrer imposanten Haltung nahm auch er sich ein wenig zusammen; zupfte sich den roten Seidenschal zurecht und klemmte sich das Monokel vors Auge. „Guten Abend, gnädige Frau, wie geht es Ihnen?“ sprach er mit der singenden Stimme, die sich am Ende der Höflichkeitsfloskel nicht hob, wodurch der formelhaft konventionelle und anmutig leere Charakter des Satzes betont ward. Die artige kleine Anrede begleitete er mit einer leichten Verneigung, die, bei aller eleganten Nachlässigkeit, doch beinah höfischen Stil hatte.
Die Witwe Mönkeberg lächelte nicht; nur die Fältchen einer erfahrenen Ironie spielten ihr ein wenig stärker um Augen und schmale Lippen, als sie erwiderte: „Beeilen Sie sich, lieber Herr Höfgen! Ihre – Lehrerin erwartet Sie schon seit einer Viertelstunde.“ Die boshafte kleine Pause, welche Frau Mönkeberg vor dem Wort „Lehrerin“ machte, bewirkte, dass Hendrik sein Gesicht heiß werden fühlte. ,Sicher bin ich ganz rot geworden’, dachte er, ärgerlich und beschämt. ,Aber sie kann es wohl hier im Halbdunkel nicht bemerken’, versuchte er, sich selbst zu beruhigen, während er sich mit der vollendeten Anmut eines spanischen Granden zurückzog.
„Ich danke Ihnen, gnädige Frau.“ Er hatte die Türe zu seinem Zimmer geöffnet.
Im Räume herrschte ein rosiges Halbdunkel; es brannte nur die mit buntem Seidentuch verhüllte Lampe auf dem niedrigen, runden Tisch neben dem Schlafsofa. In die farbige Dämmerung hinein rief Hendrik Höfgen mit einer ganz kleinen, demütigen, etwas zitternden Stimme: „Prinzessin Tebab, wo bist du?“
Aus einer dunklen Ecke antwortete ihm ein tiefes, grollendes Organ: „Hier, du Schwein – wo denn sonst?“
„Oh – danke —-“, sagte, immer noch sehr leise, Hendrik, der mit gesenktem Haupt bei der Türe stehengeblieben war. „Ja … jetzt kann ich dich sehen … Ich bin froh, dass ich dich sehen kann…“
„Wieviel Uhr ist es?“ schrie die Frau aus der Ecke. Hendrik versetzte bebend: „Ungefähr vier Uhr – denke ich.“
„Ungefähr vier Uhr! Ungefähr vier Uhr!“ höhnte die böse Person, die immer noch im Schatten unsichtbar blieb. „Ist ja drollig! Ist ja ausgezeichnet!“ Sie sprach mit einem stark norddeutschen Akzent. Ihre Stimme war ausgeschrien wie die eines Matrosen, der sehr viel säuft, raucht und schimpft. „Es ist ein Viertel nach vier Uhr“, stellte sie fest, plötzlich unheimlich leise.
Mit derselben schauerlichen Gedämpftheit, die nichts Gutes verhieß, forderte sie ihn auf: „Willst du nicht eben mal ein bisschen näher an mich ran kommen, Heinz – nur ein ganz klein bisschen! Aber erst mach das Licht an!“ Unter der Anrede „Heinz“ zuckte Hendrik zusammen wie unter dem ersten Schlag. Er gestattete es keinem Menschen, auch seiner Mutter nicht, ihn so zu nennen: Nur Juliette durfte es wagen. Außer ihr wusste es wohl niemand hier in der Stadt, dass sein eigentlicher Vorname Heinz war – ach, in welcher süßen und schwachen Stunde hatte er es ihr anvertraut? Heinz: das war der Name, mit dem alle ihn angeredet hatten, bis zu seinem achtzehnten Jahr. Erst als er sich darüber klargeworden war, dass er Schauspieler und berühmt werden wollte, hatte er sich den gewählteren „Hendrik“ zugelegt. Wie schwer war es bei der Familie durchzusetzen gewesen, dass man sich an ihn gewöhnte und ihn ernst nahm – diesen ausgefallenen, anspruchsvollen „Hendrik“! Wie viele Briefe, die mit „Mein lieber Heinz!“ begannen, hatte man unbeantwortet gelassen – bis auch die Mutter Bella und die Schwester Josy sich endlich zu der neuen Anrede bequemten. Mit Jugendfreunden, die hartnäckig bei „Heinz“ blieben, hatte man den Verkehr rigoros abgebrochen; übrigens legte man ohnedies keinen Wert auf den Umgang mit Kameraden, die peinliche Anekdoten aus einer schalen Vergangenheit mit dem wiehernden Gelächter eines taktlosen Humors hervorzuholen liebten. Heinz war gestorben; Hendrik sollte groß werden. – Der junge Schauspieler Höfgen kämpfte einen erbitterten Kampf mit den Agenturen, den Theaterdirektoren und Feuilletonredaktionen darum, dass man seinen frei erfundenen, preziösen Vornamen richtig schriebe. Er zitterte vor Zorn und Gekränktheit, wenn er sich auf einem Programm oder in einer Rezension als „Henrik“ aufgeführt fand. Das kleine „d“ in der Mitte seines selbstgewählten Namens war für ihn ein Buchstabe von ganz besonderer, magischer Bedeutung: Wenn er es erst erreicht haben würde, dass ausnahmslos alle Welt ihn als „Hendrik“ anerkannte – dann war er am Ziel, ein gemachter Mann.
Eine so dominierende Rolle spielte der Name – der mehr als eine Personalbezeichnung, nämlich eine Aufgabe und Verpflichtung war – in Hendrik Höfgens ehrgeizigen Gedanken. Trotzdem duldete er es nun, dass Juliette aus ihrer finsteren Ecke ihn drohend anredete mit dem abgelegten und verhassten „Heinz“.
Er gehorchte ihren beiden Befehlen; bewegte den Lichtschalter, so dass plötzlich eine grelle Helligkeit ihm die Augen blendete, und machte dann, die Stirn noch immer gesenkt, ein paar Schritte auf Juliette zu. Einen Meter entfernt von ihr blieb er stehen; auch dieses aber war ihm nicht gestattet. Sie murmelte mit einer heiseren und höchst beunruhigenden Freundlichkeit – wobei ihre Zähne zusammengebissen blieben: „Komm doch näher, mein Junge!“
Da er sich nicht von der Stelle bewegte, lockte sie ihn, wie einen Hund, den man mit Schmeicheltönen an sich heranholt, um dann um so grausamer zu strafen: „Nur näher, mein Schöner! Ganz nahe! Nur keine Angst!“ Er blieb immer, noch bewegungslos, immer noch mit dem geneigten Gesicht; Schultern und Arme hingen ihm schlaff nach vorne, um Schläfen und Augenbrauen trat ein leidender, gespannter Zug hervor; die geblähten Nüstern schnupperten ein penetrant süßes und gemeines Parfüm, das sich mit einem anderen, noch wilderen, aber durchaus nicht süßen Geruch – der Ausdünstung eines Körpers – auf erregende und peinigende Art vermischte.
Da das Mädchen durch seine wehleidige und edle Positur auf die Dauer gelangweilt und irritiert wurde, ließ sie plötzlich eine Zornesstimme hören, die wie heiseres Brüllen aus dem Urwald klang: „Steh doch nicht da, als ob du dir in die Hosen gemacht hättest! Kopf hoch, Mensch!“ Majestätischer fügte sie hinzu: „Blicke mir ins Gesicht!“
Er hob langsam den Kopf, während sich der Leidenszug um seine Schläfen vertiefte. Im fahlen Antlitz waren seine grünblauen Augen erweitert – vor Wonne oder vor Angst. Sprachlos starrte er auf Prinzessin Tebab, seine Schwarze Venus.
Negerin war sie nur von der Mutter her – ihr Vater war ein Hamburger Ingenieur gewesen —; aber die dunkle Rasse hatte sich als stärker erwiesen als die helle; sie sah nicht nach „Halbblut“ aus, sondern beinah nach Vollblut. Die Farbe ihrer rauhen, stellenweis etwas rissigen Haut war dunkelbraun, an manchen Partien – zum Beispiel auf der niedrigen, gewölbten Stirne und auf den schmalen, sehnigen Handrücken – fast schwarz. Heller gefärbt hatte die Natur nur das Innere ihrer Hände; während sie selbst, mittels Auflegen von Schminke, die Farbe ihrer oberen Wangenhälften eigenwillig verändert hatte: über den starken, brutal geformten Backenknochen lag das künstliche Hellrot wie ein hektischer Schimmer. Auch die Augenpartie war kosmetisch bearbeitet: die Brauen abrasiert und durch schmale Kohlestriche ersetzt; die Wimpern künstlich verlängert; die Schatten auf dem oberen Lid, und bis hinauf zu den schmalen Brauen, ins Rötlichblaue vertieft. Hingegen hatte sie den wulstigen Lippen die natürliche Farbe gelassen. Über den blendenden Zahnreihen, die sie beim Lachen wie beim Schimpfen entblößte, erschienen sie rauh, wie das Fleisch der Hände und des Halses, und von einem dunklen Violett, gegen dessen trüben Ton das gesunde Rot des Zahnfleisches und der Zunge heftig kontrastierte. In ihrem Gesicht, das von den beweglichen, grausamen und gescheiten Augen und von den blitzenden Zähnen beherrscht war, bemerkte man zunächst gar nicht die Nase; wie flach und eingedrückt sie war, erkannte man erst bei genauerem Hinschauen. Diese Nase schien in der Tat so gut wie nicht vorhanden; sie wirkte nicht wie eine Erhöhung inmitten der wüsten und auf eine schlimme Art attraktiven Maske; eher wie eine Vertiefung.
Für Juliettens höchst barbarisches Haupt hätte man sich als Hintergrund eine Urwaldlandschaft gewünscht statt dieser bürgerlichen Stube mit ihren Plüschmöbeln, Nippesfiguren und seidenen Lampenschirmen. Übrigens enttäuschte nicht nur die Dekoration, von der dieses Haupt sich abhob, sondern auch die Krönung des Hauptes selber: das Haar. Es war keineswegs die krause, schwarze Mähne, die man zu dieser Stirne, diesen Lippen passend gefunden hätte; vielmehr überraschte es durch Glattheit und eine mattblonde Färbung. Die Frisur war einfach; der Scheitel in der Mitte gezogen. Die dunkle Dame gefiel sich in der Behauptung, so seien ihre Haare immer gewesen, niemals habe sie etwas an ihnen verändert: ihre Farbe und Beschaffenheit habe sie vom Vater, dem Ingenieur Martens aus Hamburg, geerbt.
Dass ein Mann dieses Namens und dieses Berufes ihr Vater gewesen war, schien festzustehen oder wurde doch von niemandem bestritten. Übrigens war Martens seit Jahren tot. Der arbeitsreiche Aufenthalt im Inneren Afrikas war ihm nicht bekommen. Geschwächt vom Malariafieber, das Herz ruiniert von Chininspritzen und von alkoholischen Exzessen, war er nach Hamburg zurückgekehrt, um dort, eilig und ohne viel Aufsehen zu erregen, zu sterben. Das Negermädchen, das seine Geliebte gewesen war, ließ er am Kongo; ebenso das dunkelhäutige kleine Geschöpf, dessen Vater er sein mochte. Die Nachricht vom Tode des Ingenieurs drang nicht bis nach Afrika. Nach geraumer Zeit verlor Juliette auch noch die Mutter; nun machte sie sich auf in das sehr ferne, sicherlich sehr wundervolle Deutschland. Sie hoffte, dort von der väterlichen Liebe lanciert zu werden. Indessen konnte man ihr nicht einmal das Grab des Ingenieurs zeigen; die Gebeine ihres armen Vaters waren verlorengegangen wie sein Andenken.
Ein Glück für die junge Juliette, dass sie leidlich Steptanzen konnte: sie hatte es noch bei den Ihren gelernt. So gelang es ihr, bald eine Anstellung in einem der besten Etablissements von St. Pauli zu finden. Dort hätte sie sich sicherlich halten können, und vielleicht wäre der gescheiten und energischen Person ein ehrenvoller Aufstieg beschieden gewesen – hätten nur ihr heftiges Temperament und eine unbeherrschbare Neigung für starke Getränke ihr nicht den allerfatalsten Strich durch die Rechnung gemacht. Sie liebte es und konnte es gar nicht lassen, mit der Reitpeitsche auf diejenigen ihrer Bekannten und Kollegen loszugehen, mit denen sie gerade nicht in allen Stücken der gleichen Meinung oder Stimmung war: eine Angewohnheit, über die man in St.-Pauli-Kreisen sich zunächst wie über eine humoristische und niedliche Nuance ergötzte, die aber auf die Dauer gar zu originell und übrigens einfach störend wurde.
Juliette bekam ihre Entlassung und erlebte nun, in unbesorgt geschwindem Tempo, das, was man gemeinhin „von Stufe zu Stufe sinken“ nennt; das heißt: sie musste ihre Tanzkünste in immer kleineren, immer übler beleumundeten Lokalen zeigen. Ihre Einnahmen aus solcher Tätigkeit wurden nach und nach so gering, dass sie sich bald gezwungen sah, ihnen durch Nebenverdienste aufzuhelfen. Welche Beschäftigung kam in Frage, wenn nicht die des abendlichen Spaziergangs auf der Reeperbahn[30 - Reeperbahn: Vergnügungsviertel in Hamburg.] und in den benachbarten Gassen? Ihr schöner, dunkler Körper, den sie in aufrechtem, stolzem, ja fast hochmütigem Gang über das Trottoir bewegte, war wahrhaftig nicht das schlechteste Stück von diesem ungeheuren Ausverkauf der Leiber, der sich hier allnächtlich den durchreisenden Matrosen und den armen wie den ehrenwerten Männern der Stadt Hamburg bot.
Der Schauspieler Höfgen übrigens hatte die Bekanntschaft seiner Schwarzen Venus keineswegs auf dem Strich gemacht; vielmehr in der engen, vom Tabaksqualm und vom Lärm besoffener Schiffer erfüllten Kneipe, wo sie, für eine Abendgage von drei Mark, ihre dunklen, glatten Glieder und ihre kunstvoll klappernden Steps zur Schau stellte. Auf dem Programm des finsteren Kabaretts war die schwarze Tänzerin Juliette Martens als „Prinzessin Tebab“ angezeigt – ein Name, den sie nur als Künstlerin führen durfte, auf den sie aber auch im zivilen Leben Anspruch zu haben behauptete. Durfte man ihren Angaben Glauben schenken, so war ihre verstorbene Mutter, die verlassene Geliebte des Hamburger Ingenieurs, von rein fürstlichem Blute gewesen: Tochter eines veritablen, unermesslich reichen, großmütigen und leider in relativ zartem Alter von seinen Feinden verspeisten Negerkönigs. Was Hendrik Höfgen betrifft, so war er weniger von ihrem Titel beeindruckt gewesen – obwohl auch dieser ihm ganz außerordentlich gefallen hatte – als vielmehr von ihren beweglichen grausamen Augen und von den Muskeln ihrer schokoladenfarbenen Beine. Nachdem die Nummer der Prinzessin Tebab beendet gewesen war, hatte er sich in der Garderobe der Künstlerin melden lassen, um ihr seinen – zunächst vielleicht etwas überraschend klingenden – Wunsch vorzutragen: nämlich den, Tanzstunden bei ihr zu nehmen. „Heute muss ein Schauspieler trainiert sein wie ein Akrobat“, hatte Höfgen erklärend hinzugefügt; aber die Prinzessin schien nicht sehr begierig auf seine Erläuterungen. Ohne sich lang zu verwundern, hatte sie den Preis pro Stunde und das erste Rendezvous verabredet.
So war die Beziehung zwischen Hendrik Höfgen und Juliette Martens entstanden. Das dunkle Mädchen war die „Lehrerin“ – also die Herrin; vor ihr stand der bleiche Mann als der „Schüler“ – als der Gehorchende, Sich-Erniedrigende, der die häufige Strafe mit der gleichen Demut empfängt wie das seltene, karge Lob.
„Blicke mich an!“ verlangte Prinzessin Tebab und rollte schrecklich die Augen, während die seinen, zugleich begehrend und furchtsam, an ihrer gebieterischen Miene hingen.
„Wie schön du heute bist!“ brachte er schließlich hervor, wobei ihm die Lippen nur mühsam zu gehorchen schienen.
Sie fuhr ihn an: „Lass den Unsinn! Ich bin nicht schöner als sonst.“ Dabei strich sie sich aber doch eitel über den Busen und zupfte ihr enges, plissiertes Röckchen zurecht, das kurz oberhalb der Knie endete. Vom schwarzen Seidenstrumpf war nur ein knappes Stück sichtbar; denn die grünen Schaftstiefel aus geschmeidigem Lackleder reichten bis über die Waden. Zu den prächtigen Stiefeln und dem kurzen Rock trug die Prinzessin ein graues Pelzjäckchen, dessen Kragen im Nacken hochgeschlagen war. An den dunklen, sehnigen Handgelenken klirrten breite Armbänder aus gemeinem Goldblech. Das eleganteste Stück ihrer Ausstattung war die Reitpeitsche – ein Geschenk Hendriks. Sie war leuchtend rot, aus geflochtenem Leder. Juliette klopfte mit ihr, in einem kurzen, harten und drohenden Rhythmus, gegen die grünen Schaftstiefel.
„Du bist wieder eine Viertelstunde zu spät“, sagte sie, nach einer langen Pause, die niedrige und zu zwei kleinen Buckeln gewölbte Stirne in böse Falten gelegt. „Wie oft soll ich dich noch warnen, mein Süßer?“ fragte sie tückisch leise, um dann in unvermitteltem Zorne loszubrechen: „Es ist genug!! Ich habe es satt!! Gib mir deine Pfoten!“
Hendrik hob langsam die beiden Hände, deren Innenflächen er nach oben wandte. Dabei ließ er seine hypnotisierten, aufgerissenen Augen nicht von der ergrimmten, schauerlichen Fratze der Geliebten.
Sie zählte mit einer grellen, plärrenden Stimme: „Eins, zwei, drei!“, während sie zuhieb. Das Geflecht der eleganten Peitsche pfiff grausam quer über seine Handllächen, auf denen sofort dicke rote Striemen entstanden. Der Schmerz, den er empfand, war so heftig, dass er ihm das Wasser in die Augen trieb. Er verzog den Mund; beim ersten Schlag schrie er leise; dann beherrschte er sich und stand mit einem starren, weißen Gesicht.
„Für den Anfang hast du genug“, sagte sie und zeigte plötzlich ein müdes Lächeln, welches durchaus gegen die Spielregeln ging: es hatte nichts fratzenhaft Grausames, sondern enthielt gutmütigen Spott und ein wenig Mitleid. Sie ließ die Peitsche sinken, wandte den Kopf und stand – das Gesicht im Profil – in einer schönen, traurigen Haltung. „Zieh dich um!“ sagte sie leise. „Wir wollen arbeiten.“
Es gab keinen Paravent, hinter dem er hätte verschwinden können, als er die Kleidung wechselte. Unter halbgesenkten Lidern, mit einem übrigens völlig uninteressierten Blick, beobachtete Juliette jede seiner Bewegungen. Er musste alles ablegen und ihr seinen hellen, schon etwas zu fetten, rötlich behaarten Körper zeigen, ehe er in den ärmellosen, blau und weiß gestreiften Sweater und in das schwarze Turnhöschen schlüpfte. Schließlich stand er vor ihr in der unwürdigen Tracht, die er seinen „Trainingsanzug“ nannte – in der kindischen und ridikülen Aufmachung, bestehend aus schwarzen, ausgeschnittenen Halbschuhen mit weißen Söckchen, die oberhalb der Knöchel kokett umgerollt waren; aus dem kurzen Höschen von glänzend schwarzem Satin – wie die kleinen Buben es in der Turnstunde tragen – und dem gestreiften Hemd, das Hals und Arme entblößt ließ.
Sie musterte ihn, kritisch und kalt. „Du bist seit voriger Woche noch etwas dicker geworden, mein Süßer“, konstatierte sie, wobei sie mit der Peitsche höhnisch gegen ihre grünen Stiefel klopfte. „Entschuldige“, bat er leise.
Die Schwarze machte sich am Grammophon zu schaffen. In die Jazzmusik hinein, deren rhythmischer Lärm plötzlich einsetzte, sagte sie rauh: „Fang schon an!“ Dabei fletschte sie die beiden Reihen ihrer gar zu weißen Zähne und bewegte grimmig die Augen: Dies genau war das Mienenspiel, das er jetzt von ihr erwartete und verlangte.
Ihr Gesicht stand vor ihm wie die schreckliche Maske eines fremden Gottes: Dieser thront mitten im Urwald, an verborgener Stelle, und was er fordert mit seinem Zähneblecken und Augenrollen, das sind Menschenopfer. Man bringt sie ihm, zu seinen Füßen spritzt Blut, er schnuppert mit der eingedrückten Nase den süß vertrauten Geruch, und er wiegt ein wenig den majestätischen Oberkörper nach dem Rhythmus des wild bewegten Tamtams; Um ihn vollführen seine Untertanen den verzückten Freudentanz. Sie schleudern die Arme und Beine, sie hüpfen, schaukeln sich, taumeln; aus ihrem Gebrüll wird Wonnegestöhn, aus dem Gestöhn wird ein Keuchen, und schon sinken sie hin, lassen sich lallen vor die Füße des schwarzen Gottes, den sie lieben, den sie ganz bewundern – wie Menschen nur den lieben und ganz bewundern können, dem sie das Kostbarste geopfert haben: Blut.
Hendrik hatte langsam zu tanzen begonnen. Aber wohin war die triumphale Leichtigkeit, die von Publikum und Kollegen an ihm bewundert wurde? Sie war verschwunden; nur unter Qualen schien er jetzt die Füße zu setzen – freilich unter Qualen, die auch Wonnen waren: dies verrieten das selbstvergessene Lächeln der fahlen, aufeinandergepressten Lippen und der benommene Blick.
Juliette ihrerseits dachte nicht daran, zu tanzen; sie ließ den Schüler sich alleine plagen. Nur durch Händeklatschen, rauhe Schreie und rhythmisches Schaukeln des Leibes feuerte sie ihn an. „Schneller, schneller!“ forderte sie wütend. „Was hast du denn in den Knochen? Und du willst ein Mann sein?! Du willst ein Schauspieler sein und dich auch noch für Geld sehen lassen? – Da, du komisches Stückchen Elend…“
Die Peitsche fuhr ihm über die Waden und über die Arme. Diesmal traten ihm keine Tränen in die Augen, welche trocken und glühend blieben. Nur seine zusammengepressten Lippen zitterten. Prinzessin Tebab schlug noch einmal zu.
Er arbeitete, ohne jede Unterbrechung, eine halbe Stunde lang, als handelte es sich um ein ernsthaftes Training anstatt um eine etwas schauerliche Lustbarkeit. Schließlich keuchte er heftig. Er taumelte. Sein Gesicht war schweißbedeckt. Mühsam brachte er hervor: „Mir ist schwindlig. Darf ich aufhören…?“
Sie erwiderte, mit einem Blick auf die Uhr, kurz und sachlich: „Mindestens noch eine Viertelstunde musst du springen.“
Da die Musik wieder plärrte und Juliette wieder frenetisch in die Hände klatschte, versuchte er noch einmal den komplizierten Step. Aber die gequälten Füße, in ihren koketten Halbschuhen und Söckchen, verweigerten ihm den Dienst. Hendrik schwankte eine Sekunde lang; stand darin still; wischte sich mit der zitternden Hand den Schweiß von der Stirne.
„Was machst du für Scherze?“ grollte sie. „Du hörst auf, ohne meine Erlaubnis?! Das wäre ja das Allerneueste und noch das Schönere!“
Sie zielte mit der roten Peitsche nach seinem Gesicht; er duckte sich noch rechtzeitig, um diesem fürchterlichen Schlage zu entgehen. Abends ins Theater kommen mit einer blutigen Strieme von der Stirn bis zum Kinn: das wäre denn doch etwas zuviel gewesen. Trotz der benommenen Stimmung, in der er sich befand, blieb ihm klar, dass er sich dergleichen keinesfalls leisten durfte. „Lass das!“ sagte er kurz. Während er sich schon von ihr abwendete, fügte er noch hinzu: „Genug für heute.“
Sie verstand, dass dies kein Spaß mehr war. Ohne etwas zu antworten, mit einem erleichterten kleinen Seufzer, schaute sie ihm zu, wie er in seinen üppig gefütterten, rotseidenen, übrigens an mehreren Stellen zerrissenen Schlafrock schlüpfte und sich auf dem Ruhebett niederließ.
Das Sofa, welches man für die Nacht als Bett herrichten konnte, war tagsüber bedeckt mit Tüchern und bunten Kissen. Neben dem Kanapee[31 - Kanapee: Sofa, Couch.] stand die Lampe auf dem runden, niedrigen Rauchtisch.
„Mach das grelle Licht aus!“ bat Hendrik mit der singenden, wehleidigmelodischen Stimme. „Und komme zu mir, Juliette!“
Durch das rosige Halbdunkel schritt sie auf ihn zu. Als sie neben ihm stehenblieb, seufzte er leise: „Wie gut!“
„Hat es dir Spaß gemacht?“ fragte sie ziemlich trocken. Sie hatte sich eine Zigarette angezündet und reichte auch ihm Feuer; er benutzte zum Rauchen die lange, ordinäre Zigarettenspitze, das Geschenk der Rahel Mohrenwitz. „Ich bin völlig erledigt“, sagte er. Daraufhin verzog sie ihren gewaltigen Mund zu einem gutmütigen und verständnisvollen Lächeln. „Das ist recht“, sagte sie, wobei sie sich über ihn beugte.
Er hatte seine breiten, bleichen, rötlich behaarten Hände auf ihre edlen, von schwarzer Seide überglänzten Knie gelegt. Träumerisch sprach er: „Wie hässlich meine gemeinen Hände auf deinen herrlichen Beinen aussehen, Geliebte!“
„An dir ist alles hässlich, mein Schweinchen – Kopf, Füße, Hände, und alles!“ versicherte sie ihm mit einer knurrenden Zärtlichkeit.
Sie ließ sich neben ihn hingleiten. Das graue Pelzjäckchen hatte sie abgelegt; darunter trug sie eine knappe, hemdartige Bluse aus einem stark glänzenden, rot und schwarz karierten Seidenstoff.
„Ich werde dich immer lieben“, sagte er erschöpft. „Du bist stark. Du bist rein.“
Dabei schaute er, unter gesenkten Lidern, auf ihre harten und spitzen Brüste, die sich unter dem eng anliegenden, dünnen Gewebe deutlich abhoben.
„Ach, das sagst du nur so“, meinte sie ernst und ein wenig verächtlich. „Das bildest du dir nur ein. Manche Leute haben das – dass sie sich immer so was einbilden müssen. Sonst fühlen sie sich nicht wohl.“
Er tastete mit seinen Fingern nach ihren hohen und geschmeidigen Stiefeln. „Aber ich weiß doch, dass ich dich immer lieben werde“, flüsterte er, nun mit geschlossenen Augen. „Nie wieder finde ich eine Frau wie dich. Du bist die Frau meines Lebens, Prinzessin Tebab.“ Sie wiegte misstrauisch ihr dunkles, ernstes Gesicht über seinem weißen, ermüdeten. „Und dabei darf ich nicht einmal ins Theater gehen, wenn du spielst“, sagte sie unzufrieden.
Er hauchte: „Trotzdem spiele ich nur für dich – nur für dich, meine Juliette. Ich hole bei dir meine Kraft.“
„Aber ich lasse mir’s nicht verbieten“, sagte sie trotzig. „Ich gehe ins Theater, ob du es mir erlaubst oder nicht. Nächstens einmal sitze ich im Parkett, und dann lache ich laut, wenn du auf die Bühne kommst, mein Affe.“
Er sagte hastig: „Mach keine Witze!“ Dabei hatte er erschreckt die Augen geöffnet und sich halb aufgerichtet. Der Anblick seiner Schwarzen Venus schien ihn wieder zu beruhigen. Er lächelte, und nun begann er sogar zu rezitieren.
„Vienstu du ciel profond ou sorstu de l’abîme – o Beauté?“[32 - Kommst du vom Himmel, steigst du auf aus tiefen Schlünden, o Schönheit?]
„Was ist denn das für ein Quatsch?“ fragte sie ungeduldig.
„Das ist aus diesem herrlichen Buch da“, erklärte er ihr, und deutete auf eine gelb broschierte französische Edition, die neben der Lampe auf dem Rauchtisch lag – es waren „Les Fleurs du Mal“ von Baudelaire.
„Das verstehe ich nicht“, sagte Juliette verdrossen. Er aber ließ sich nicht stören in seiner Ekstase, sondern fuhr fort:
„Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu temoques;
De tes bijoux l’Horreur n’est pas le moins charmant,
El le Meurtre, parmi l es plus chères breloques,
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement.“[33 - Dein Weg, o Schönheit, führt dich spottend über Leichen,Das Graunen dient dir als Geschmeid und schenkt dir Lust,Doch mit dem Mord kann sich kein anderer Schmuckvergleichen,Er tanzt als Kronjuwel verliebt auf deiner Brust.Charles Baudlaire „Les Fleurs du Mal“ (Die Blumen des Bösen); aus der „Hymne à la Beauté (Hymne an die Schönheit) in der Übersetzung von Carl Fischer.]
„Wie magst du nur so blöd lügen“, sagte sie und berührte mit ihrem dunklen und schlanken Finger seinen redenden Mund.
Er aber sprach weiter, immer mit demselben, melancholisch singenden Ton: „Du erzählst mir nie davon, wie du früher gelebt hast, Prinzessin Tebab. Ich meine: in deinem Erdteil…“
„Ich kann mich an nichts mehr erinnern“, sagte sie kurz. Dann küsste sie ihn – vielleicht nur, um ihn daran zu hindern, noch länger indiskrete und poetische Fragen zu stellen: ihr weit geöffneter, tierischer Mund mit den dunklen, rissigen Lippen und der blutroten Zunge näherte sich langsam seinem gierigen, fahlen Mund.
Sowie sie ihr Gesicht wieder von dem seinen erhoben hatte, redete er weiter. „Ich weiß nicht, ob du mich vorhin verstanden hast, als ich sagte, dass ich nur für dich und nur durch dich spiele.“ Während er so weich und träumerisch sprach, führte sie ihre geübten Finger durch sein schütteres Seidenhaar, auf dessen Fahlheit die Lampe ein wenig Goldglanz zauberte. Sie behandelte sein feines Haar auf eine nicht eigentlich zärtliche, sondern auf eine ernste und sachliche Art, als wollte sie es frisieren. „Ich habe es ganz wörtlich gemeint“, fuhr er fort. „Wenn ich den Leuten ein bisschen gefalle, wenn ich Erfolg habe – dir verdanke ich ihn. Dich zu sehen, dich zu berühren, Prinzessin Tebab: das ist wie eine Wunderkur für mich… etwas Herrliches, eine Erfrischung ganz ohnegleichen…“
„Ach, wenn du nur immer schwatzen und lügen kannst“, sagte sie mütterlich. „Du bist doch der drolligste kleine Dreckhaufen, dem ich jemals begegnet bin.“ Sie hatte, um ihn nur zum Schweigen zu bringen, ihre beiden Hände auf sein Gesicht gelegt; die breiten Armbänder klirrten an seinem Kinn; auf seinen Wangen ruhten die hellen Innenflächen ihrer Hände. Da endlich verstummte er. Er rückte seinen Kopf auf dem Kissen zurecht, als wollte er einschlafen. Gleichzeitig schlang er mit einer hilfesuchenden Gebärde seine beiden Arme um das schwarze Mädchen. Während sie ganz still in seiner Umarmung hielt, ließ sie die Hände auf seinem Gesicht liegen, als müsste sie ihn davor bewahren, das zärtlichhöhnische Lächeln zu sehen, mit dem sie jetzt auf ihn niederblickte.
III
Knorke
Die Saison ging weiter, es war keine schlechte Saison für das Hamburger Künstlertheater. Oskar H. Kroge war entschieden ungerecht gewesen, als er gesagt hatte, Höfgen werde überzahlt mit tausend Mark Monatsgehalt. Ohne diesen Schauspieler und Regisseur hätte das Institut gar nicht auskommen können; er leistete Enormes, war so unermüdlich wie einfallsreich. Er spielte alles, jugendliche Rollen und alte: nicht nur Miklas hatte Anlass, auf ihn eifersüchtig zu sein, sondern auch Petersen, und sogar Otto Ulrichs hätte ihn gehabt; aber der war mit wichtigeren Dingen beschäftigt und nahm den bürgerlichen Theaterbetrieb nicht ganz ernst. Höfgen gewann sich die Kinderherzen als witziger und schöner Prinz im Weihnachtsmärchen; die Damen fanden ihn unwiderstehlich in französischen Konversationsstücken und in den Komödien von Oscar Wilde[34 - Wilde, Oscar (
1854, †1900), irischer Schriftsteller, schrieb geistreiche Gesellschaftsstücke, Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“, Märchen, Gedichte.]; der literarisch interessierte Teil des Hamburger Publikums diskutierte seine Leistungen in „Frühlings Erwachen“, als Advokat in Strindbergs „Traumspiel“, als Leonce in Büchners „Leonce und Lena“. Er konnte elegant sein, aber auch tragisch. Er hatte das „aasige“ Lächeln, aber auch den Leidenszug an den Schläfen. Er bezauberte mit übermütigem Esprit, er imponierte mit herrisch gerecktem Kinn, abgehacktem Kommandoton und stolznervösen Gebärden; er rührte durch Demut, hilflos irrenden Blick, weltfremd zarte Verstörtheit. Er war gütig oder gemein, hochfahrend oder zärtlich, schneidig oder gebrochen – ganz wie das Repertoire es verlangte. In Schillers „Kabale und Liebe“ spielte er abwechselnd den Major Ferdinand und den Sekretarius Wurm, den überschwenglichen Liebhaber und den ruchlosen Intriganten: dabei hätte er es kaum nötig gehabt, seine Wandlungsfähigkeit, an der niemand zweifelte, solcherart kokett zu betonen. Vormittags hatte er Proben zum „Hamlet“, nachmittags zu einer Posse „Mieze macht alles“. Die Posse kam zum Silvesterabend[35 - Silvester: der letzte Tag des Jahres, der 31. Dezember.] heraus und wurde ein starker Erfolg. Schmilz konnte zufrieden sein; über den „Hamlet“ raste Kroge, der noch auf der Generalprobe die Aufführung untersagen wollte. „Eine solche Schweinerei habe ich niemals geduldet in meinem Hause!“ empörte sich der alte Vorkämpfer des literarischen Theaters. „Hamlet erledigt man nicht nebenbei wie einen Reißer“. Höfgen erledigte ihn; sah sehr eindrucksvoll aus in seiner hochgeschlossen en schwarzen Tracht, mit rätselhaft schielenden Augen und fahlem Leidensgesicht, und bekam am nächsten Vormittag von der Hamburger Presse versichert, dass es eine interessante Leistung gewesen sei, nicht ganz durchgearbeitet vielleicht, etwas improvisiert, aber doch voll packender Momente. Angelika Siebert hatte die Ophelia spielen dürfen und war auf jeder Probe schier zerflossen vor Tränen; bei der Premiere hatte sie wegen heftigen Weinens kaum auftreten können. Übrigens fanden dann einige Kenner, ihre Leistung sei eigentlich die beste gewesen in dieser bedenklichen Inszenierung.
Höfgen arbeitete sechzehn Stunden am Tag und hatte jede Woche mindestens einen Nervenzusammenbruch. Diese Krisen traten stets sehr heftig und in abwechslungsreichen Formen auf. Einmal fiel Höfgen zur Erde und zuckte stumm; das nächste Mal hingegen blieb er zwar stehen, schrie aber grauenhaft, und dies fünf Minuten lang ohne jegliche Unterbrechung; dann wieder behauptete er auf der Probe, zum Entsetzen aller, er bekomme plötzlich seine Kiefer nicht mehr auseinander, ein Krampf habe eingesetzt, es sei scheußlich, nun könne er nur noch murmeln, und das tat er denn auch. Vor der Abendvorstellung, in der Garderobe, ließ er sich von Bock – der seine sieben Mark fünfzig noch immer nicht wiederhatte – die untere Gesichtshälfte massieren, stöhnte und murmelte mit aufeinandergepressten Zähnen. Eine Viertelstunde später, auf der Bühne, gehorchte ihm sein Mundwerk wie je; er benutzte es mit Geschicklichkeit, strahlte und hatte Erfolg.
Die kleine Angelika litt; Höfgen kümmerte sich nicht darum. Frau von Herzfeld litt; er speiste sie ab mit intellektuellen Konversationen. Rolf Bonetti litt, um der kleinen Angelika willen, die spröde blieb, wie eigensinnig und eifrig er sich auch um sie bewarb; so musste sich der schöne junge Liebhaber mit Rahel Mohrenwitz trösten: dieses tat er widerwillig und ohne dass darum die angeekelten Züge verschwunden wären aus seinem Gesicht. Hans Miklas hasste; hungerte – wenn die Efeu ihm nicht gerade Butterbrote schenkte —; schimpfte mit seinen politischen Freunden auf Marxisten, Juden und Judenknechte; trainierte zäh, bekam kleine Rollen und unterhalb der Backenknochen immer schwärzere Löcher.
Mit seinen politischen Freunden steckte auch Otto Ulrichs viel zusammen. Gerade vor ihnen war es ihm peinlich, dass die Eröffnung des Revolutionären Theaters immer wieder hinausgeschoben wurde. Jede Woche erfand Höfgen eine andere Ausrede. Es geschah häufig, dass Ulrichs nach der Probe den Freund beiseite nahm, um zu flehen: „Hendrik! Wann fangen wir an!“ Dann redete Höfgen, schnell und leidenschaftlich, von der Verwerflichkeit des Kapitalismus, vom Theater als politischem Instrument, von der Notwendigkeit einer kraftvollen, durchgearbeiteten, künstlerisch-politischen Aktion, und versprach schließlich, unmittelbar nach der Premiere von „Mieze macht alles“ mit den Proben für das Revolutionäre Theater zu beginnen.
Jedoch ging die stimmungsvolle Silvesterpremiere vorüber; viele andere Premieren folgten, die Saison nahte sich ihrem Ende, sie war fast vorbei: vom Revolutionären Theater gab es noch immer nicht mehr als das schöne Briefpapier, auf dem Höfgen eine hochgestimmte und verzweigte Korrespondenz mit prominenten Autoren sozialistischer Gesinnung führte. Als Otto Ulrichs wieder einmal bat und drängte, erklärte Hendrik ihm, für diese Saison sei es, tief bedauerlicherweise und infolge eines Zusammenkommens von fatalsten Umständen, zu spät geworden: man müsse leider bis zum nächsten Herbst warten. Diesmal verfinsterte sich Ulrichs Miene; Hendrik aber legte dem Freund und Gesinnungsgenossen den Arm um die Schulter und redete auf ihn ein mit jener durchaus unwiderstehlichen Stimme, die erst sang und bebte, dann heftig und schneidend wurde; denn nun geißelte Höfgen die moralische Verkommenheit der Bourgeoisie und pries die internationale Solidarität des Proletariats. Ulrichs war zu versöhnen. Man trennte sich mit langem Händedruck.
Damals wurde eben die letzte Novität für diese Spielzeit vorbereitet: in Theophil Marders Komödie „Knorke“ sollte Hendrik Höfgen die Hauptrolle spielen. Das gesellschaftskritischdramatische Werk Marders hatte großen Ruhm; alle Kenner priesen seine höchst persönlich geprägte Form, seine unfehlbare Bühnenwirksamkeit und geistvoll unbarmherzige Bosheit. Zu der „Knorke“-Uraufführung würden die Kritiker aus Berlin herbeigereist kommen. Übrigens erwartete man auch den Autor – nicht ohne Herzklopfen; denn Marders unerbittlich hohe Meinung von sich selber war ebenso bekannt wie seine grimmige Schnoddrigkeit und seine Neigung zu jäh aus dem Nichts geholten heftigen und dauerhaften Streitigkeiten.
Bei aller Angst aber freute sich Höfgen auch auf die Ankunft des berühmten Dramatikers; er zweifelte kaum daran, dass dem Hellsichtigen und Erfahrenen seine Leistung auffallen werde. „Ich muss gut werden in ,Knorke’!“ schwor Hendrik sich.
Damit er sich nur ganz der Rolle widmen konnte, überließ er dieses Mal die Regie dem Direktor Kroge, der ein alter Spezialist für die Komödien des Theophil Marder war. „Knorke“ gehörte in einen Zyklus von satirischen Stücken, die das deutsche Bürgertum unter Wilhelm II.[36 - Wilhelm II. (
1859, †1941), deutscher Kaiser und König von Preußen; erzwang 1890 den Rücktritt Otto von Bismarcks, liebte forsches Auftreten und äußeren Pomp; wurde durch seine Unbedachtheit dem selbst auferlegten Führungszwang nicht gerecht. Am 9.11.1918 wurde in Berlin seine Abdankung verkündet, er ging in die Niederlande.] schilderten und verhöhnten. Held der Komödie war der Emporkömmling, der mit dem zynisch verdienten Geld, mit dem ordinären Elan seines Wesens und einer skrupellosen, niedrigen, selbstbewussten Intelligenz sich Macht und Einfluss in den höchsten Kreisen erobert. Knorke war grotesk, aber auch imposant. Er repräsentierte den parvenühaft-emporschießenden, vitalen, ganz dem Geist entfremdeten bourgeoisen Typus. Höfgen versprach großartig zu werden in dieser Rolle. Er hatte ihre grausam schneidenden Akzente und zuweilen ihre beinah rührende Hilflosigkeit. Keine Frage: Höfgen musste Sensation machen in diesem Stück.
Seine Partnerin, Knorkes Lebensgefährtin, die nicht weniger skrupellos ist als er selber, und schwächer nur dadurch, dass sie liebt: dass sie Knorke liebt – seine Partnerin in der genialen Komödie spielte ein junges Mädchen, das von Theophil Marder in energisch oder beinah zornig abgefassten Briefen dringend empfohlen worden war. Nicoletta von Niebuhr besaß noch wenig praktische Theatererfahrung – nur ganz selten war sie aufgetreten, und dies in kleineren Städten —; aber ein selbstsicheres, fast einschüchterndes Wesen. Marder hatte dem armen Oskar H. Kroge in krassen Ausdrücken mit dem grässlichsten Skandal gedroht, falls die Direktion des Künstlertheaters Fräulein von Niebuhr nicht für ein erstes Fach engagieren würde. Kroge, der vor des Dramatikers fürchterlicher Diktion klein und ängstlich wurde, ließ Nicoletta in „Knorke“ probeweise gastieren. Sie kam angereist, mit vielen Handkoffern aus rotem Lackleder, einem breitrandigen schwarzen Herrenhut zu einem brennend roten Gummimantel, einer großen gebogenen Nase und leuchtenden Katzenaugen unter einer hohen, schönen Stirn. Alle bemerkten sogleich, dass sie eine Persönlichkeit war: die Motz konstatierte es mit ehrfurchtsvoll bewegter Stimme im H. K., und niemand mochte ihr widersprechen, selbst Rahel Mohrenwitz nicht, obwohl diese sich über die Ankunft der Neuen ärgerte; denn ganz entschieden war auch Nicoletta eine dämonische junge Dame, sie brauchte weder Monokel noch lange Zigarettenspitze, um es der Welt zu beweisen.
Rolf Bonetti und Petersen diskutierten darüber, ob Nicoletta schön zu nennen sei. Der enthusiastische Petersen fand sie „einfach blendend“; der vorsichtige Kenner Bonetti wollte sie nur als „interessant“ bezeichnet wissen. „Von schön kann doch gar nicht die Rede sein, bei der Nase!“ sagte er wegwerfend. „Aber ihre Augen sind herrlich“, schwärmte Petersen, wobei er um sich blickte, ob die Motz nicht in der Nähe war. „Und wie sie sich hält! Majestätisch, möchte man beinah sprechen!“ – Draußen ging Nicoletta vorbei, Arm in Arm mit Höfgen, was viel bemerkt ward. Ihr Kopf mit der kühnen Nase, dem leuchtenden Blick und der großen Stirn glich dem eines Renaissance-Jünglings: dies stellte, mit leidvoller. Einsicht, Frau von Herzfeld fest, die das Paar eifersüchtig verfolgte. Nicoletta hielt sich sehr gerade. Ihre grell geschminkten, scharfen Lippen formten die Worte mit einer schneidenden Präzision; jeder Satz klirrte vor Akkuratesse; die Vokale sprach sie ganz weit vorn, so dass sie blank und flach klangen, kein Konsonant ging verloren, noch die beiläufigste Floskel wurde zum Triumph der Sprachtechnik.
Gerade war Nicoletta dabei, mit dämonischer Sorgfalt zu betonen, dass sie ehrgeizig sei, und, wenn es sein müsse, auch intrigant. „Natürlich, mein Liebling!“ sagte sie schneidend zu Höfgen, den sie seit ein paar Stunden kannte. „Vorwärtskommen wollen wir alle. Man muss Ellenbogen haben.“ Hendrik, der sie sich neugierig von der Seite beschaute, dachte darüber nach, ob sie in diesem Augenblick aufrichtig sei oder posierte. Es war schwer zu entscheiden. Vielleicht war gerade dieser radikal entschlossene Zynismus die Maske, hinter der sie ein ganz anderes Gesicht verbarg. Wer wusste aber, ob dieses andere versteckte Gesicht auch eine so kühne Nase und einen so scharfen Mund hatte wie die Miene, die sie jetzt mit Stolz zur Schau trug?
Hendrik konnte sich nicht verhehlen, dass die Frau an seiner Seite ihm Eindruck machte. Ohne Frage, sie war die erste, seitdem er Juliette kannte, für die er einen beteiligten, interessierten Blick hatte. Er beichtete es der Schwarzen Venus noch am selben Tage und bekam furchtbare Schläge – die diesmal nicht aus rituellen Gründen und weil es so zum Spiel gehörte verabreicht wurden, sondern aus Überzeugung und mit echter Leidenschaft; denn Prinzessin Tebab ärgerte sich. Hendrik litt, stöhnte, genoss und versicherte am Ende seiner Prinzessin, dass sie die eigentliche Herrin und Geliebte bleiben würde. Als er aber Nicoletta wiedersah, faszinierten ihn wieder ihre schneidende Sprechweise, ihr blanker, durchdringender Blick und ihre stolz zusammengenommene Haltung.
Es gefiel ihm auch, was sie ihm in präziser Sprache über ihre Herkunft und Vergangenheit anvertraute. Ihm imponierte das Exzentrische, Abenteuerlich-Fragwürdige, da er selbst aus den bürgerlichsten Verhältnissen kam. Nicoletta erzählte, dass sie ihre Eltern nicht gekannt habe. „Mein Papa war ein Hochstapler“, konstatierte sie erhobenen Hauptes, fröhlich und stolz. „Mama ist eine kleine Tänzerin an der Pariser Oper gewesen, sehr dumm, wie ich höre; aber sie soll die himmlischsten Beine gehabt haben.“ Sie blickte herausfordernd auf ihre eigenen, mit denen sie nur angab, als wären sie himmlisch. „Papa war ein Genie. Immer verstand er es, auf größtem Fuß zu leben. Er ist in China gestorben, wo er siebzehn Teehäuser und enorme Schulden hinterließ. Das einzige Andenken, das ich an ihn besitze, ist seine Opiumpfeife.“ In ihrem Hotelzimmer wies sie Hendrik die Reliquie vor. Mit einer Korrektheit, hinter der man lauter Teufelei vermuten musste, fragte sie ihn, ob er Tee haben wollte oder Kaffee. Die Bestellung rief sie durch das Telefon dem Kellner zu wie einen fürchterlichen, mit eisiger Mitleidlosigkeit vorgebrachten Urteilsspruch. Dann erzählte sie ausführlich von ihrer Jugend. „Gelernt habe ich gar nicht viel“, sagte sie. „Aber ich kann auf den Händen gehen, auf einer rollenden Kugel laufen und wie eine Eule schreien.“ Ihre Fibel sei die sehr empfehlenswerte Zeitschrift „La Vie Parisienne“ gewesen. Aufgewachsen war sie teils in französischen Internaten, aus denen man sie wegen fürchterlicher Ungezogenheit stets bald wieder entfernt hatte; teils im Hause des Geheimrats Bruckner, den sie einen Jugendfreund ihres Vaters nannte.
Vom Geheimrat Bruckner hatte Höfgen schon gehört. Die Werke des Historikers waren berühmt; übrigens kannte Hendrik sie nicht. Hingegen wusste er, dass des Geheimrats gesellschaftliche Stellung ebenso bedeutend wie ungewöhnlich war. Der Forscher und Denker war nicht nur eine der exponiertesten und meistbesprochenen Figuren der deutschen und europäischen akademisch-literarischen Welt; man sagte ihm auch intime und einflussreiche Verbindungen zu politischen Kreisen nach. Seine Freundschaft mit. einem sozialdemokratischen Minister war bekannt; andererseits hatte er Beziehungen zur Reichswehr: seine verstorbene Frau war die Tochter eines Generals gewesen. Viel Anlass zu Kommentaren hatte eine Vortragstournee des Geheimrats durch Sowjetrussland gegeben. Damals war von der nationalistischen Presse die große Hetze gegen ihn eröffnet worden. Seitdem stellte man gerne mit Erbitterung fest, die Geschichtsbetrachtung Bruckners sei marxistisch beeinflusst. Es geschah, dass die Studenten lärmten, als er das Katheder betrat. Seine Weltgeltung und seine ruhige, überlegene Haltung schüchterten die Aufgeregten ein. Der Geheimrat ging siegreich hervor aus den Skandalen. Er blieb unantastbar.
„Der Alte ist wundervoll“, sagte Nicoletta von ihm. „Er versteht auch etwas von Menschen; an Papa zum Beispiel hatte er eine große Anhänglichkeit. Deshalb ließ er sich von mir immer alles gefallen – und ich meinerseits hatte Geduld mit seiner feinen Langweiligkeit.“
Nicolettas beste Freundin, ihre eigentliche Schwester, war Barbara, Bruckners Tochter. „Ein so schönes Geschöpf! Und so gut!“ Nicolettas Blick wurde weicher, während sie dies sagte; aber auf die klirrend exakte Aussprache konnte sie nicht verzichten. – Zu der „Knorke“-Premiere wurde nicht nur Theophil Marder erwartet, sondern auch das Mädchen Barbara. „Ich bin neugierig, ob du sie mögen wirst“, sagte Nicoletta zu Hendrik. „Vielleicht liegt sie dir nicht besonders. Aber sei bitte nett zu ihr, mir zu Gefallen. – Sie ist etwas scheu“, stellte Nicoletta fest und schmetterte die Vokale.
Am Tag der großen Premiere traf Barbara Bruckner ein; Marder kam erst gegen Abend, mit dem Berliner Schnellzug. Höfgen machte Barbaras Bekanntschaft, als er, unmittelbar vor Beginn der Vorstellung, einen Kognak in der Kantine trank. Nicoletta sprach mit musterhafter Deutlichkeit und greller Stimme: „Dieses ist meine liebste Freundin, Barbara Bruckner!“ – wozu sie eine zeremonielle Geste unter dem schwarzen, steif plissierten Cape vollführte. Hendrik war zu aufgeregt, um sich das junge Mädchen genauer zu betrachten. Er stürzte seinen Kognak hinunter und verschwand. In der Garderobe fand er zwei große Blumensträuße: weißen Flieder von Angelika Siebert, und von der Herzfeld zart teegelb getönte Rosen. Um sich durch ein gutes Werk die Gunst des Himmels zusichern, überreichte Höfgen dem kleinen Bock – der vor Premieren stets etwas weinerlich aussah – mit großer Geste fünf Mark, wodurch freilich die Sieben-Mark-fünfzig-Schuld noch immer nicht völlig getilgt war.
Die Uraufführung der Komödie „Knorke“ verlief glänzend: Marders beißende Pointen schlugen knallend ein, die steile Führung des Dialogs kitzelte das Publikum zu halb entsetzten, halb beglückten Gelächtern, vor allem aber begeisterte das exakte, schnoddrig-pathetische, in jeder Hinsicht blendende Zusammenspiel zwischen Höfgen und der neuen Kraft, Nicoletta von Niebuhr, die „auf Engagement gastierte“. Nach dem zweiten Akt mussten die beiden Hauptdarsteller sich dem animierten Saal häufig zeigen. In der Pause erschien Theophil Marder bei Höfgen, Nicoletta geleitete ihn.
Marders unruhiger, aber durchdringender Blick musterte alle Gegenstände in der Garderobe, zuletzt Hendrik selbst, der erschöpft vorm Spiegel saß. Nicoletta war, respektvoll schweigend, an der Tür stehengeblieben. Nach langer Pause sagte Marder mit. einer penetranten Kommandostimme: „Sie sind ja ’ne dolle Type!“ Seine grausam fixierenden Augen wichen nicht von Hendriks schön geschminktem Gesicht.
„Sind Sie zufrieden, Herr Marder?“ Höfgen suchte den Satiriker durch Juwelenblicke und angegriffenes Lächeln zu bezaubern. Theophil aber sagte: „Na ja…“ und fügte unverschämt hinzu; „Na ja, Herr – wie war doch der Name?“ Nun war Hendrik doch etwas beleidigt; trotzdem nannte er seinen Namen mit der singendwerbenden Stimme. Daraufhin machte Marder: „Hendrik – Hendrik – ulkiger Name, muss ich schon sagen, sehr ulkig!“: so höhnisch, dass es Höfgen eisig über den Rücken lief. Plötzlich aber rief der Dichter mit einer beängstigenden Fröhlichkeit: „Hendrik! Wieso Hendrik?! Natürlich heißen Sie eigentlich Heinz! – Heißt eigentlich Heinz, nennt sich Hendrik! Hahaha, das ist aber mal gut!“ Er lachte gellend, herzlich und ausführlich. Höfgen, aus Entsetzen über so viel böse Hellsicht, war bleich geworden unter seiner rosigen Maske und zitterte. Nicoletta, ohne einzugreifen, schaute mit blanken Katzenaugen amüsiert vom einen zum andern. Theophil war schon wieder ernst. Er schien nachzudenken; dabei bewegte er ununterbrochen den bläulichen Mund unter dem schwarzen Schnurrbart. Das erregte Spiel seiner Lippen erinnerte auf eine unheimliche Art an das gierige Saugen fleischfressender Pflanzen oder schnappender Fischmäuler. Abschließend sagte Marder: „Sind aber ’ne dolle Type. Starkes Talent – rieche das, habe verdammt feine Nase. Sprechen uns noch. Essen nachher zusammen. Komm, Kind!“ Er nahm Nicoletta am Arm und verließ die Garderobe. Höfgen blieb im Zustand völliger Konsterniertheit zurück.
Er gewann seine Fassung erst wieder, als er auf der Bühne und im Rampenlicht stand – dort freilich völlig. Im dritten Akt übertraf er alles, was er an bravourösem Elan bis dahin jemals öffentlich gezeigt hatte. Das Auditorium raste, nachdem der Vorhang gefallen war. Nicoletta, die Arme voll Blumen, fiel Höfgen um den Hals und sagte: „Theophil hat wieder mal das rechte Wort gefunden! Du bist wirklich eine tolle Type!“ Kroge trat hinzu, um Anerkennendes zu murmeln. Er versicherte Fräulein von Niebuhr, dass es ihm ein Vergnügen sein werde, weiter mit ihr zu arbeiten; sie möchte sich morgen vormittag ins Büro bemühen, damit man die Bedingungen bespreche. Nicoletta machte sofort ihr hinterhältig-korrektes Gesicht, verneigte sich feierlich und gab in scharfen Worten ihrer Befriedigung über diesen Entschluss des Direktors Ausdruck.
Theophil Marder hatte die beiden jungen Damen und den Schauspieler Höfgen in ein sehr teures, mehr bürgerlich-solides als mondänes Lokal eingeladen. Hendrik war hier noch niemals gewesen, was Marder Anlass gab, schneidend festzustellen, dies sei die einzige „Bude“ in Hamburg, wo Genießbares auf den Tisch komme – solide Kost, guter alter Stil, wenn man dem Dramatiker glauben durfte —; überall sonst gebe es ranziges Fett und stinkende Braten, hier aber verkehrten feine alte Herren, die noch zu leben missten; auch sei der Weinkeller gepflegt. Wirklich saßen in der braun getäfelten Stube, an deren Wänden Jagdbilder und schöne Teppiche hingen, nur bejahrte Väter, die nach Millionenvermögen aussahen. Noch würdevoller freilich als sie alle wirkte der Oberkellner: in dem Respekt, mit dem er Theophils Bestellungen entgegennahm, ließ sich ein klein wenig Ironie vermuten. Marder schlug vor, man möge mit Langusten beginnen. „Was meinen Sie, bester Heinrich?“ erkundigte er sich bei Höfgen mit jener hinterhältigen Korrektheit, die Nicoletta bei ihm gelernt haben mochte. Hendrik hatte nichts einzuwenden. Übrigens fühlte er sich etwas unsicher und befangen in dem herrschaftlichen Lokal. Ihm wollte es scheinen, als habe der Oberkellner mit Geringschätzung seinen Smoking gemustert, der fleckig war und an einigen Stellen speckig glänzte. Unter dem taxierenden Blick des feinen Kellners ward[37 - ward: поэт. impf. от werden] Hendrik sich, flüchtig, aber mit Heftigkeit, seiner umstürzlerischen Gesinnung bewusst. ,Ich gehöre nicht in dieses Lokal für kapitalistische Ausbeuter’, dachte er zornig, während er sich Weißwein eingießen ließ. Nun bereute er es, die Eröffnung des Revolutionären Theaters immer wieder hinausgeschoben zu haben. Von Marder aber war er enttäuscht. Dieser unbarmherzige, hellsichtige und gefährliche Kritiker der bourgeoisen Gesellschaft zeigte sich, da man ihm nun von Mensch zu Mensch gegenübersaß, als ein Herr mit bedenklich reaktionären Neigungen. Er hatte eine schnarrende Kommandostimme, einen tückischen Blick, trug einen viel zu tadellos gearbeiteten dunklen Anzug mit sorgfältig gewählter Krawatte, und von den Langusten, die nun serviert wurden, suchte er mit einer fatalen Kennerschaft die schönsten aus. Hatte er nicht mit jenen Figuren, die er in seinen Stücken verhöhnte, viele Eigenschaften gemein? Nun lobte er die gute alte Zeit, in der er jung gewesen und mit der die neue, oberflächliche, verkommene in keinem Punkte sich messen könne. Dabei hielt er fortwährend die kalten, unruhigen und gierigen Augen auf Nicoletta gerichtet, die ihrerseits nicht nur den Mund schlängelte, sondern auch den Körper in einem metallisch glitzernden Abendkleid. Barbara saß still dabei. Hendrik, degoutiert durch Nicolettas provokant betonten Flirt mit Marder, vielleicht auch nur eifersüchtig, wandte seine Aufmerksamkeit endlich Barbara zu. Da bemerkte er: ihr Blick war forschend auf ihn gerichtet gewesen. Hendrik Höfgen erschrak.
Mitten in seinem Herzen erschrak er darüber, dass er Barbara Bruckner begnadet fand mit einem Reiz, den er noch an keiner anderen Frau je wahrgenommen hatte. Ihm waren schon vielerlei Frauen begegnet, aber noch keine wie diese. Während er diese anschaute, erinnerte er sich, in geschwinder, aber genauer Zusammenfassung – so, als gälte es, einen Schlussstrich zu ziehen unter eine lange und beschmutzte Vergangenheit —, aller jener weiblichen Geschöpfe, mit denen er je zu tun gehabt hatte.
Sie hatte Hendrik forschend betrachtet, während er sich noch mit Marder und Nicoletta beschäftigte. Da er sie nun seinerseits anstarrte – nicht verführerisch schielend, nicht rätselhaft schillernd, sondern mit der echten Ergriffenheit, die hilflos macht —, senkte sie den Blick und wandte den Kopf halb zur Seite.
Ihr sehr einfaches schwarzes Kleid, dem der Kenner seine Herkunft von der kleinen Hausschneiderin angemerkt hätte und zu dem sie einen weißen, schulmädchenhaft steifen Kragen trug, ließ den Hals und die mageren Arme frei. Das empfindliche und genau geschnittene Oval ihres Gesichtes war blass; Hals und Arme waren bräunlich getönt, golden schimmernd, von der reifen und zarten Farbe sehr edler, in einem langen Sommer duftend gewordener Äpfel. Hendrik musste angestrengt darüber nachdenken, woran ihn diese kostbare Farbe, von der er noch betroffener war als von Barbaras Antlitz, erinnerte. Ihm fielen Frauenbilder Leonardos ein, und er war etwas gerührt darüber, dass er hier, in aller Stille, während Marder mit seiner Kenntnis alter französischer Kochrezepte prahlte, an so vornehme und hohe Gegenstände dachte; ja, auf gewissen Leonardo-Bildern gab es diese satte, sanfte, dabei spröd empfindliche Fleischfarbe; auch einige seiner Jünglinge, die den gekrümmten, lieblichen Arm aus einer schattenvollen Dunkelheit hoben, zeigten sie. Jünglinge und Madonnen auf alten Meisterbildern hatten solche Schönheit.
An Jünglinge und Madonnen ließ der Anblick Barbara Bruckners den begeisterten Hendrik denken. Nach dem Ideal geformte Knaben hatten diese schöne Magerkeit der Glieder; Madonnen aber hatten dieses Gesicht. So schlugen sie die Augen auf, genau so, wie Barbara es jetzt tat: Augen unter langen, schwarzen und starren, aber ganz natürlichen Wimpern; Augen von einem satten Dunkelblau, das ins Schwärzliche spielte. Solche Augen hatte Barbara Bruckner, und sie schauten ernst forschend, mit einer freundschaftlichen Neugier, und zuweilen beinah schalkhaft. Überhaupt war das edle Gesicht nicht ohne schalkhafte Züge: kein weinerliches, auch kein gebieterisches Madonnenantlitz, vielmehr ein durchtriebenes. Der ziemlich große und feuchte Mund lächelte versonnen, aber nicht ohne Witz. Dem träumerischen Frauenhaupt gab es eine fast kecke Note, dass der Knoten des reichen aschblonden Haares im Nacken ein wenig schief saß. Der Scheitel hingegen war genau und in der Mitte gezogen.
„Warum schauen Sie mich so an?“ fragte Barbara schließlich, da der entzückte Hendrik den Blick nicht von ihr ließ.
„Darf ich nicht?“ fragte er leise zurück.
Sie sagte mit einer burschikosen Koketterie, hinter der ihre Befangenheit sich verbarg: „Wenn es Ihnen Vergnügen macht…“
Hendrik fand: Ihre Stimme war für das Ohr der nämliche Genuss wie die Farbe ihrer Haut für das Auge. Auch ihre Stimme schien gesättigt von reifem und zartem Ton. Auch sie schimmerte, hatte den kostbar nachgedunkelten Glanz. Hendrik lauschte mit derselben Hingegebenheit, die er vorhin gehabt hatte beim Schauen. Damit sie nur weiterspräche, stellte er Fragen. Er wollte wissen, wie lange sie in Hamburg zu bleiben gedächte. Sie sagte, während sie mit einer Ungeschicklichkeit, die den Mangel an Gewohnheit verriet, an ihrer Zigarette sog: „Solange Nicoletta hier spielt. Es hängt also vom Erfolg des ,Knorke’ ab.“
„Jetzt freut es mich erst, dass das Publikum heuteabend so lange geklatscht hat“, sagte Hendrik. „Ich glaube, auch die Presse wird gut sein.“ – Er erkundigte sich nach ihren Studien – Nicoletta hatte erwähnt, dass Barbara die Universität besuchte. Sie sprach von soziologischen, historischen Kollegs. „Aber ich betreibe ja all das viel zu unregelmäßig“, sagte sie, versonnen und etwas spöttisch. Dabei stützte sie den Ellenbogen auf den Tisch und das Gesicht in die schmale, bräunliche Hand. Ein nicht so wohlwollender Beobachter, wie Hendrik es in diesem Augenblick war, hätte ihre Bewegungen, die ihm von schöner, rührender Befangenheit schienen, ungeschickt und beinah plump finden können. Die Steifheit ihrer Haltung verriet die junge Dame aus der Provinz, die nicht durchaus gewandte Professorentochter, und kontrastierte zu der klugen und heiteren Offenheit ihres Blickes. Sie hatte die Unsicherheit eines Menschen, der in einem bestimmten, eng begrenzten Milieu viel geliebt und verwöhnt worden ist, außerhalb dieses Milieus aber zu Minderwertigkeitsgefühlen neigt. Besonders in Nicolettas Gegenwart schien Barbara es gewöhnt zu sein, eine zweite Rolle zu spielen. Sie war deshalb erfreut und ein wenig belustigt darüber, dass dieser wunderliche Schauspieler, Hendrik Höfgen, auf eine so demonstrative Art sich ihr widmete, und sie setzte das Gespräch mit ihm nicht ungern fort.
„Ich mache so alles mögliche“, sagte sie nachdenklich. „Eigentlich zeichne ich… Mit Theater-dekorationen habe ich mich viel beschäftigt.“ Dies war ein Stichwort für Hendrik; er ließ die Unterhaltung lebhafter werden. Mit fliegendem Eifer, auf den Wangen eine helle Röte, sprach er von Wandlungen des dekorativen Stils, von all dem, was es auf diesem Gebiete neu zu entdecken oder wieder zu verwenden, zu verbessern gäbe. Barbara lauschte, antwortete, blickte prüfend, hatte Lächeln, rührend ungeschickte Gebärden der Arme, schalkhaft und versonnen tönende Stimme, die verständige, durchdachte Urteile sprach.
Hendrik und Barbara plauderten leise, angeregt, nicht ohne Innigkeit. Nicoletta und Marder inzwischen funkelten sich verführerisch an. Beide ließen alle ihre Künste spielen. Nicolettas schöne Raubtieraugen waren noch blanker als sonst; die Akkuratesse ihrer Aussprache bekam triumphalen Charakter. Zwischen den grell gefärbten Lippen leuchteten, wenn sie lachte und sprach, die kleinen und scharfen Zähne. Marder seinerseits ließ intellektuelles Feuerwerk sprühen. Sein beweglicher, zuckender Mund, dessen bläuliche Färbung äußerst ungesund wirkte, redete fast ununterbrochen. Übrigens hatte Marder die Neigung, mit größter Intensität immer wieder dieselben Dinge zu sagen. Vor allem bestand er mit einer passionierten Hartnäckigkeit darauf, dass die heutige Zeit, deren aufmerksamsten und berufensten Richter er sich nannte, die denkbar schlechteste, verkommenste und hoffnungsloseste aller Epochen sei. Es existierte in ihr keine geistige Bewegung, keine allgemeine Tendenz oder besondere Leistung, die sein fürchterlicher Anspruch irgend hätte gelten lassen. Vor allem fehlten in ihr, seiner Meinung nach, die Persönlichkeiten; er, Marder, war die einzige weit und breit, und er wurde verkannt. Das Verwirrende war, dass der Beobachter und Richter europäischen Verfalls dieser trostlosen Gegenwart keineswegs das Bild einer Zukunft entgegensetzte, die zu lieben und um derentwillen das Bestehende zu hassen wäre; dass er vielmehr, um das Seiende herabzusetzen, eine Vergangenheit pries, die doch gerade er durchschaut, verhöhnt und kritisch erledigt hatte. Die fiebrig animierte Nicoletta war nicht dazu geneigt, sich über irgend etwas zu wundern; sonst hätte es ihr wohl erstaunlich scheinen können, dass eben der Mann, der sich selbst den klassischen Satiriker der bürgerlichen Epoche zu nennen liebte, nun Offiziere der alten deutschen Armee und rheinische Industrielle zu Idealfiguren verklärte, die tadellose Disziplin und kühne Persönlichkeit sieghaft in sich vereinigten. Der alte Spötter, dessen selbstherrlicher, aber geistig richtungsloser Radikalismus ins Reaktionäre abgeglitten und entartet war, deklamierte schnarren-des Lob für die physischen und moralischen Qualitäten preußischer Generale und denunzierte mit der gereizten Stimme eines Unteroffiziers die schlappe Weichlichkeit des heutigen Geschlechts. „Nirgends Zucht! Nirgends Disziplin!“ schrie er so laut und zornig, dass die alten Herren, die bei ihren Rotweinflaschen saßen, erstaunt die Köpfe herdrehten. Auch die Frauen hatten jede Disziplin verloren, behauptete der aufgebrachte Marder. Sie verstanden nichts mehr von der Liebe, aus der Hingabe machten sie ein Geschäft, wie die Männer waren sie oberflächlich und vulgär geworden. Hier lachte Nicoletta so herausfordernd, dass Marder galant hinzufügte: „Ausnahmen gibt es natürlich!“
Dann aber begann er wieder zu schimpfen. Seine Ansicht ging dahin, die deutschen Männer hätten allen Sinn für Ordnung und Respekt verloren, seitdem die allgemeine Dienstpflicht abgeschafft war. Heute, in einer verlotterten Demokratie, sei alles Talmi, falsch, durch Reklame groß gemachter Betrug. „Wenn es anders wäre“, fragte Marder erbittert, „müsste ich dann nicht der erste Mann im Staate sein? Wäre die ungeheure Kraft und Kompetenz meines Hirns nicht dazu berufen, alle wesentlichen Dinge öffentlichen Lebens zu entscheiden – während heute, da jeder Instinkt und Maßstab für echten Rang abhanden kam, meine Stimme nur die beinah überhörte des öffentlichen schlechten Gewissens ist!“ Seine Augen glühten, sein hageres Gesicht, dessen Blässe zu der Schwärze des Schnurrbarts kontrastierte, war verzerrt. Um ihn zu beruhigen, erinnerte Nicoletta daran, dass die Stücke keines anderen lebenden Autors so häufig aufgeführt würden wie die seinen. Er lächelte mit flüchtig befriedigter Eitelkeit. Aber schon nach wenigen Sekunden verfinsterte er sich wieder. Plötzlich schrie er Hendrik Höfgen an, der innig vertieft in sein Gespräch mit Barbara saß: „Haben Sie vielleicht gedient, Herr?“
Hendrik, überrascht und entsetzt von so drohender Anrede, wandte ihm ein ziemlich fassungsloses Gesicht zu. Marder aber verlangte: „Antworten Sie, Herr!“ Hendrik brachte, mühsam lächelnd, hervor: „Nein, natürlich nicht… Gott sei Dank nicht…“ Darauf lachte Marder triumphierend.
„Da sieht man es wieder! Keine Disziplin! Keine Persönlichkeit! – Haben Sie vielleicht Disziplin, Herr? Sind Sie vielleicht eine Persönlichkeit? – Alles Talmi, alles Ersatz, Plebejertum, wohin ich immer schaue!“!
Das war eine Impertinenz; Hendrik wusste nicht, wie er reagieren sollte. Er fühlte Zorn in sich hochsteigen; um der Damen willen, und auch, weil Marders Ruhm ihm imponierte, entschloss er sich, einen Skandal zu vermeiden. Übrigens hielt er den Schriftsteller für nervenkrank. Welch erstaunliche und erschütternde Veränderung aber ging nun vor mit Marder, der eine schauerlich gedämpfte Stimme und prophetische Augen bekam!
„Das alles wird grässlich enden.“ Er raunte es – in welche Fernen oder in was für Abgründe schaute jetzt sein Blick, der mit einemmal eine so fürchterlich durchdringende Kraft bekam? „Es wird das Schlimmste geschehen, denkt an mich, Kinder, wenn es da ist, ich habe es vorausgesehen und vorausgewusst. Diese Zeit ist in Verwesung, sie stinkt. Denkt an mich: Ich habe es gerochen. Mich täuscht man nicht. Ich spüre die Katastrophe, die sich vorbereitet. Sie wird beispiellos sein. Sie wird alles verschlingen, und um keinen wird es schade sein, außer um mich. Alles, was steht, wird zerbersten. Es ist morsch. Ich habe es befühlt, geprüft und verworfen. Wenn es stürzt, wird es uns alle begraben. Ihr tut mir leid, Kinder, denn ihr werdet euer Leben nicht leben dürfen. Ich aber habe ein schönes Leben gehabt.“
Theophil Marder war fünfzig Jahre alt. Er war mit drei Frauen verheiratet gewesen. Er war angefeindet und ausgelacht worden; er hatte den Erfolg, den Ruhm und auch den Reichtum kennen gelernt.
Da er schwieg und nur erschüttert keuchte, sprachen auch die anderen, die mit ihm am Tisch saßen, kein Wort; Nicoletta, Barbara und Hendrik hatten die Augen niedergeschlagen.
Marder aber änderte jäh die Stimmung. Er schenkte Rotwein ein und wurde charmant. Höfgen, den er eben noch beleidigt hatte, machte er nun Komplimente über sein begabtes Spiel. „Ich weiß es wohl“, sagte er gönnerhaft, „die Rolle ist blendend, mein Dialog unvergleichlich pointiert. Aber die Jammergestalten, die sich heute Schauspieler nennen, bringen es fertig, selbst in meinen Stücken schwunglos langweilig zu sein. Sie, Höfgen, haben immerhin eine Ahnung davon, was Theater ist. Unter den Blinden fallen Sie mir als der Einäugige auf, Prost!“ Dabei hob er das Rotweinglas. „Mit unserer Barbara scheinen Sie sich ja nicht übel zu unterhalten“, sagte er launig. Barbara begegnete seinem anzüglichen Lächeln mit ernstem Blick. Hendrik zögerte, ehe er mit Theophil anstieß: die forsche Redeweise des Dramatikers im Zusammenhang mit dem wunderbaren Mädchen Barbara empfand er als unpassend. Es schien, dass Marder, der nicht nur mit seiner Kenntnis von Weinen und Saucen, sondern auch mit seinem untrügbaren Instinkt für den Wert einer Frau dröhnend renommierte, Barbara überhaupt nicht bemerkte. Augen hatte er nur für Nicoletta, die es ihrerseits sorgsam vermied, den zärtlichen und besorgten Blick zu erwidern, den Barbara zuweilen auf sie richtete.
Marder bestellte Champagner zu den Süßigkeiten, die der feine Ober eben servierte. Es war nach Mitternacht; das gediegene Lokal, in dem es keine Gäste mehr gab außer diesen vier sonderbaren, hätte längst seine Pforten geschlossen; aber Marder gab den Kellnern zu verstehen, sie würden anständige Trinkgelder bekommen, wenn sie ein wenig länger als gewöhnlich ihren Dienst taten. Der große Satiriker, das wachsame Gewissen einer verderbten Zivilisation, zeigte jetzt sein Talent zur harmlosen Gemütlichkeit. Er erzählte Witze, und zwar sowohl solche aus preußisch-militärischer als auch andere aus östlichjüdischer Sphäre. Ab und zu schaute er Nicoletta an, um zu konstatieren: „Prachtvolles Mädel! Disziplinierte Person! Heute sehr seltene Sache!“ Oder er betrachtete sich Höfgen und rief munter: „Dieser sogenannte Hendrik – eine dolle Type! Kolossal ulkiges Phänomen! Macht mir Spaß. Muss ich mir notieren!“
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/klaus-mann/mephisto-mefistofel-kniga-dlya-chteniya-na-nemeckom-yazyke/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Wilhelmstraße: eine Straße in den Berliner Ortsteilen Mitte und Kreuzberg. Sie war der Sitz wichtiger Regierungsbehörden Preußens und des Deutschen Reiches. Bis 1945 war der Begriff „Wilhelmstraße“ ein Synonym für diedeutsche Regierung.
2
Exzellenz: verwendet als Anrede oder Titel für hohe Diplomaten.
3
SS: eine Art militärisch organisierter Polizei in der Zeit des Nationalsozialismus.
4
Hohenzollern: Das Haus Hohenzollern ist eines der bedeutendsten deutschen Fürstengeschlechter, ursprünglich aus dem schwäbischen Raum. Es untergliederte sich seit dem Mittelalter in mehrere Haupt- und Nebenlinien, von denen einige wieder erloschen sind. Die (ursprünglich fränkische) Linie Brandenburg-Preußen stellte ab 1701 die preußischen Könige und von 1871 bis 1918 die Deutschen Kaiser. Das Haus Hohenzollern stellte außerdem von 1866 bis 1947 die rumänischen Könige.
5
Prolet: jemand, der sehr schlechte Manieren hat.
6
Clemenceau, Georges Benjamin, frz. Staatsmann; 1906 bis 1909 und 1917 bis 1920 Minister-Präsident; setzte die frz. Forderungen gegenüber Deutschland im Versailler Vertrag durch.
7
Briand, Aristide, frz. Staatsmann; war elfmal Ministerpräsident, 1925 bis 1932 Außenminister, beteiligt am Locarno-Pakt.
8
Abbé [frz. „Abt“]: in Frankreich Titel des Weltgeistlichen.
9
Damned snob: verdammter Snob.
10
Renkontre: Treffen, Begegnung.
11
Königin Luise (
1776, †1810), Königin von Preußen, Gemahlin Friedrich Wilhelms III.
12
Cäsar: Beiname eines Zweigs des römischen Geschlechts der Julier, auch römischer Herrscher und Thronfolger. Aus dem Namen Cäsar entstanden die Wörter Kaiser und Zar.
13
Minna von Barnhelm: die Titelrolle eines Stücks von Gotthold Ephraim Lessing (1767). „Minna von Barnhelm“ war das erste deutsche realistische Lustspiel.
14
Novemberrevolution: deutsche Revolution im November 1918. Sie begann am 30.10. mit dem Marinenaufstand in Kiel, führte am 7.11. zum Sturz der bayerischen Monarchie und am 9.11. zur Abdankung Kaiser Wilhelms II. Alle deutschen regierenden Fürsten wurden enttrohnt, in Deutschland wurde die Republik ausgerufen.
15
Wedekind, Frank (
1864, †1918), deutscher Dichter, satirischer Dramatiker, suchte die konventionelle bürgerliche Moral als Unmoral zu enthüllen.
16
Strindberg, August (
1849, †1912), schwedischer Dichter; nahm den Weg vom Naturalismus über den Individualismus zur Mystik; gestaltete den Kampf der Geschlechter und die seelische Zerrissenheit.
17
Kaiser, Friedrich Carl Georg (
1878, † 1945), der erfolgreichste Dramatiker der expressionistischen Generation. Aus seinem Wirken als Autor gingen 60 Dramen hervor, von denen aber viele in Vergessenheit geraten sind.
18
Sternheim, Carl (
1878, †1942), deutscher Dramatiker; schrieb satirische Komödien.
19
Unruh, Fritz von (
1885, †1970), deutscher Schriftsteller; Pazifist.
20
Hasenclever, Walter (
1890, †1940), deutscher Dichter; schrieb expressionistische Dramen, Lustspiele, Lyrik.
21
Toller, Ernst (
1893, †1939), deutscher Schriftsteller; 1919 Mitglied der Münchener Räteregierung; Pazifist, emigrierte 1933 in die USA.
22
Tagore, Rabindranath (
1861, †1941), indischer Dichter, Philosoph; schrieb in Bengali und Englisch Romane, Dramen und Gedichte. Nobelpreis für Literatur 1913.
23
„Raub der Sabinerinnen“: eine Komödie von Franz
24
„Pension Schöller“: ein Lustspiel von Wilhelm Jacobi und Carl Laufs. Die Uraufführung fand am 7. Oktober 1890 in Berlin statt.
25
„Die Weber“: ein soziales Drama in fünf Akten von Gerhart Hauptmann, das am 26. Februar 1893 im neuen Theater Berlin privat und am 25. September 1894 im Deutschen Theater Berlin öffentlich uraufgeführt wurde. Es behandelt den Weberaufstand von 1844.
26
Leviten, A.T.: die Tempeldiener aus dem Stamm Levi.
27
der Vertrag von Versailles: der am 28.6.1919 in Versailles von den Ententemächten und dem Deutschen Reich zur Beendigung des ersten Weltkrieges unterzeichnete Friedensvertrag.
28
„Frühlings Erwachen“: ein Drama von Frank Wedekind.
29
„Die Räuber“: ein Drama von Friedrich Schiller.
30
Reeperbahn: Vergnügungsviertel in Hamburg.
31
Kanapee: Sofa, Couch.
32
Kommst du vom Himmel, steigst du auf aus tiefen Schlünden, o Schönheit?
33
Dein Weg, o Schönheit, führt dich spottend über Leichen,
Das Graunen dient dir als Geschmeid und schenkt dir Lust,
Doch mit dem Mord kann sich kein anderer Schmuckvergleichen,
Er tanzt als Kronjuwel verliebt auf deiner Brust.
Charles Baudlaire „Les Fleurs du Mal“ (Die Blumen des Bösen); aus der „Hymne à la Beauté (Hymne an die Schönheit) in der Übersetzung von Carl Fischer.
34
Wilde, Oscar (
1854, †1900), irischer Schriftsteller, schrieb geistreiche Gesellschaftsstücke, Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“, Märchen, Gedichte.
35
Silvester: der letzte Tag des Jahres, der 31. Dezember.
36
Wilhelm II. (
1859, †1941), deutscher Kaiser und König von Preußen; erzwang 1890 den Rücktritt Otto von Bismarcks, liebte forsches Auftreten und äußeren Pomp; wurde durch seine Unbedachtheit dem selbst auferlegten Führungszwang nicht gerecht. Am 9.11.1918 wurde in Berlin seine Abdankung verkündet, er ging in die Niederlande.
37
ward: поэт. impf. от werden
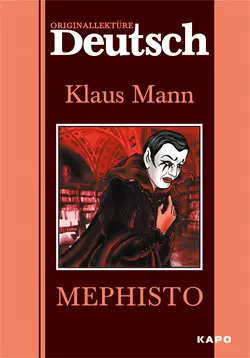
Клаус Манн
Тип: электронная книга
Жанр: Немецкий язык
Язык: на немецком языке
Стоимость: 209.00 ₽
Издательство: КАРО
Дата публикации: 18.10.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Клаус Манн (1906-1949) – немецкий писатель и журналист, сын Томаса Манна.